monopoli
Der 6. Oktober 1989 war schon ein kühler Tag. Michail Gorbatschow, zu dem Zeitpunkt Generalsekretär des ZK der KPdSU, hatte den Mantel übergezogen, als er auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld die Maschine der Aeroflot verließ. Sein Besuch galt den Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik.
Auf der langen Fahrt zu seiner Residenz in Niederschönhausen beeindruckten ihn die vielen erwartungsvollen »Gorbi! Gorbi!« -Rufe der Hauptstädter.
Wohl die meisten, die ihm Sympathie bekundeten, gingen davon aus, dass er gern in die DDR gekommen sei und von ihm als einem Mann ehrlicher sozialistischer Überzeugung guter Rat in schwieriger Situation zu erwarten sei.
Es war jedoch – wie Dokumente inzwischen belegen – ganz anders.
Noch vor dem Abflug nach Berlin hatte Gorbatschow – so hat es sein engster Mitarbeiter Anatoli Tschernjajew im Tagebuch festgehalten – erklärt, dass er den bevorstehenden Besuch der DDR im Grunde nicht mag, und dass er »zur Unterstützung Honeckers kein Wort sagen« werde.
Zwei Tage danach lobte der Generalsekretär jedoch vor dem Politbüro der DDR: »Wenn ich an diesem Jubiläumstage über unsere gemeinsamen Probleme nachdenke, komme ich zu dem Schluss, dass im Vortrag des Genossen Honecker derjenige Teil äußerst wichtig ist, der das Thema eurer Zukunft behandelt.«
Doch Zukunft sollte die DDR aus Gorbatschows Sicht nicht mehr haben. Am 11. Oktober bezeichnete er gegenüber seinen Mitarbeitern Honecker als »Mudak«, als »Arschgeige«. Gorbatschow war offensichtlich die Fähigkeit eigen, jeder Person an jedem Ort das zu erklären, von dem er annahm, dass es der andere gerne höre.
So war es auch bei seinem Besuch in Juni 1989 in Bonn. In seinen offiziellen Reden erschien es, als ob Gorbatschow sich für die DDR einsetzte. Im vertraulichen Gespräch mit Kanzler Helmut Kohl akzeptierte er die Äußerung seines Gastgebers, der meinte, die deutsche Vereinigung komme so sicher, wie der Rhein in das Meer fließe.
Vom stürmischen Herbst 1989 trennen uns inzwischen 25 Jahre. Noch immer wird darüber gestritten, wie es zu dem Zusammenbruch des politischen Systems in der DDR und in allen anderen sozialistischen Staaten Europas kommen konnte. Erfolgte die Liquidierung des Sozialismus infolge immanenter Schwächen, oder war es eine Niederlage im internationalen Klassenkampf? War etwa auch Verrat im Spiel?
Zweifellos befanden sich die UdSSR und andere Staaten des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe aufgrund des Kalten Krieges, aber auch infolge der unter dem damaligen KPdSU-Generalsekretär und Staatschef Leonid Breshnew (1964–1982) sich ausbreitenden Stagnation und Verkrustung des politischen Systems in einer schwierigen Lage. Unbeantwortet bleibt darum bisher die Frage, warum die Entscheidungsträger der UdSSR in dieser Krisensituation nicht den Weg zu sozialistischen Werten und Lösungen fanden. Eine Veränderung des politischen Systems den Realitäten entsprechend, eine effektive Wirtschaftsstrategie und eine für jedermann erlebbare sozialistische Demokratie lagen doch nicht außerhalb des Möglichen und Notwendigen.
Fraglos stand in der Mitte des 20. Jahrhunderts nach der Überwindung der unmittelbaren Folgen des Zweiten Weltkrieges – insbesondere unter dem Druck der sich weltweit auswirkenden wissenschaftlich-technischen Revolution – auch die sozialistische Gemeinschaft vor neuen qualitativen Herausforderungen. Es zeigte sich jedoch, dass die in deren Führung gesammelten Erfahrungen für die Bewältigung der Zukunftsaufgaben im ökonomischen und sozialen Bereich der sozialistischen Staaten nicht ausreichten. Die Abkehr von den Methoden Stalins öffnete zwar das Tor für neue Erkenntnisse. Sie führte jedoch allein damit noch nicht zur notwendigen durchdachten Strategie für das »Wie weiter?«. Nicht selten ersetzten in der Zeit von Breshnews Vorgänger Nikita Chruschtschow sympathische Elemente der Empathie die erforderliche theoretische Tiefe bei der Lösung anstehender strategischer Fragen.
In den 20 Jahren der Stagnation, die danach mit Breshnew folgten, wurden bekanntlich Ansätze neuer kreativer Lösungen (wie beim „Neuen ökonomischen System in der DDR“) verketzert und verhindert. Ohne eine kreative Theorie wurde jedoch einer weitsichtigen Politik, dem innerparteilichen Leben und der sozialistischen Demokratie zunehmend der Boden entzogen. Das über Jahrzehnte stabile politische System des Sozialismus, das ärgsten Widrigkeiten standhielt, erodierte, wurde zu einer kritischen Masse. Der Verdacht gewann Nahrung, dass in den 1980er Jahren Politiker mit großem Einfluss die dem Sozialismus innewohnenden Potenzen unterschätzten. Sie erarbeiteten folglich keine tragfähige Konzeption für eine Revitalisierung des sozialistischen Systems und ignorierten die wachsenden Gefahren für dessen Zukunft.
US-Unterwanderungsstrategie zu Liquidierung des Sozialismus
Brent Scowcroft, der Sicherheitsberater des US-Präsidenten Georg H. W. Bush, erklärte 1989 zur Liquidierung des Sozialismus: »Wir hatten einen Plan, Gorbatschow nicht.« Dieser Plan der USA nahm nach der Niederlage im Vietnamkrieg im Jahr 1975 Gestalt an. Er erwuchs aus der Erkenntnis, dass der Sozialismus mit vorwiegend militärischen Mitteln nicht bezwungen werden kann.
In der »Chicagoer Schule« hatte der Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman vor allem mit seinem Werk »Kapitalismus und Freiheit« theoretische Grundlagen für eine neue Staatsstreichtheorie geschaffen. Sein Konzept ging davon aus: »Nur eine Krise – eine tatsächliche oder empfundene – führt zu einem echten Wandel.«
Als engster Berater des chilenischen Diktators Augusto Pinochet beim Putsch gegen den gewählten Präsidenten Salvador Allende orientierte Friedman 1973 auf einen Umbau der Wirtschaft – man könnte sagen – im Schnellfeuertempo. Dieses für die Chilenen so schmerzhafte Vorgehen nannte Friedman »Schocktherapie«.
Sein Konzept zielte darauf, in Krisenzeiten nicht zu zögern, sondern überrumpelnd zu handeln, um einem von der Krise erfassten Land unumkehrbare Veränderungen aufzuzwingen.
Seit den 1970er Jahren bildeten sich im Dunstkreis der neoliberalen „Chicagoer Schule“ in den USA gut finanzierte, einflussreiche Institutionen mit dem Ziel, Lösungen ohne Waffengewalt für die Zurückdrängung und Beseitigung des Sozialismus zu kreieren.
Diesem Ziel dienten regierungsnahe Stiftungen, darunter die vom Milliardär George Soros finanzierte Organisation »Freedom House«. Soros’ Strategie besagt: »Breite Kampagnen auf ziviler Basis haben größere Aussicht, demokratische Ergebnisse zu erbringen als Militärinterventionen – außerdem kosten sie erheblich weniger.«
1973 veröffentlichte der US-amerikanische Politikwissenschaftler Gene Sharp sein Buch »Die Politik der gewaltfreien Aktion«. Diese handliche Gebrauchsanleitung für Staatsstreichvorbereitungen wurde in 30 Sprachen übersetzt. In großer Auflage wurde es in der Bundesrepublik unter dem Titel »Von der Diktatur zur Demokratie« verbreitet.
Grünen-Gründerin Petra Kelly übergab in den 1980er Jahren »Bürgerrechtlern« der DDR Sharps Handlungsanleitungen. Gerd Poppe, einer von ihnen und späteres Grünen-Mitglied, wertete das nachträglich als wichtige Inspiration für den Herbst 1989.
»Gorbatschow, Jakowlew und Schewardnadse – Kunst der Verstellung«
Gibt es einen Zusammenhang zwischen der beschriebenen Strategie der USA und Gorbatschows Politik zur Liquidierung der sozialistischen Staaten Europas? Starke Indizien sprechen dafür.
Am 6. Mai 1991 besuchte der sowjetische Außenminister Eduard A. Schewardnadse seinen Amtskollegen in den USA, James Baker. Zeugen des Gesprächs veröffentlichten zwei Jahre danach Schewardnadses Erinnerungen. Im Buch von Michael R. Beschloss und Strobe Talbot »At the Highest Levels« heißt es: »dass unser Team – Gorbatschow, Jakowlew und Schewardnadse – zu Beginn der Gorbatschow-Ära zwischen zwei Modellen der Perestroika entscheiden musste. (…) Wir hatten die Wahl zwischen einer Schocktherapie und einer schrittweisen medikamentösen Behandlung«.
Den drei prominenten Perestroika-Vertretern schwebte demnach als Strategiemodell nur die eine oder die andere Version der US-amerikanischen neoliberalen Politik, nicht aber eine Besinnung auf sozialistische Werte vor.
Eine solche anti-revolutionäre Politik war nur mit perfiden Mitteln der Täuschung der Kommunisten und ihrer Sympathisanten sowie der Öffentlichkeit zu erreichen.
Alexander Jakowlew – er war Gorbatschows Berater – bekannte 2003 in seinem Buch »Die Abgründe meines Jahrhunderts«: »Paradoxerweise musste man um Glasnost im geheimen kämpfen, zu unterschiedlichen Tricks, gar zur primitiven Lüge Zuflucht nehmen.«
Die Frage, ob Gorbatschow für derartige Hinterhältigkeit vorbereitet war, beantwortete Jakowlew mit den Worten: »In gewisser Hinsicht ja. An die Kunst der Verstellung musste sich keiner von uns gewöhnen. Diese war der Stil der Denk- und Lebensweise. Gorbatschow bereitete es Vergnügen, mit Kompromissen zu spielen. Ich beobachtete diesen kurzweiligen Spieltrieb mehrfach und begeisterte mich an seiner Meisterschaft.«
Gorbatschow war ein notorischer Doppelzüngler. In seinen 1996 erschienenen »Erinnerungen« schrieb er: »Hätten wir die Fragen, die uns beschäftigen, bereits im April 1985 der Öffentlichkeit unterbreitet, (…) so hätten wir kaum Zustimmung gefunden. Man hätte uns mehr oder weniger scharf widersprochen, uns als Phantasten hingestellt und schleunigst der Führung enthoben.«
Mit Reden hatte Gorbatschow über Jahre seine oft aufmerksamen Zuhörer betört. Am Ende seiner politischen Laufbahn waren das opferreiche Werk und die Hoffnungen von Millionen anständigen Menschen zerstört und die Resultate des Sieges über den Hitlerfaschismus eliminiert.
Dieser Vorgang ohnegleichen ist nur damit zu erklären, dass seit Stalin der Generalsekretär des ZK der KPdSU über eine unkontrollierte, uneingeschränkte Machtfülle verfügte.
Während Gorbatschow so gut wie alles im sowjetischen System infrage stellte – den übernommenen Status des unkontrollierbaren, allmächtigen Generalsekretärs ließ er unangetastet. Er nutzte ihn für seine Zwecke. In seiner eloquenten Art nahm er aufrechte Anhänger des Sozialismus für sich ein. Seine reale Politik führte jedoch zu einem völlig anderen Ergebnis. Der Sozialismus wurde nicht bereichert, er erhielt nicht – wie immer wieder erklärt – ein menschliches Antlitz. Er wurde beseitigt.
Gorbatschows Zukunftsvision war die Preisgabe der DDR
Das Konzept der Preisgabe der DDR nahm in Moskau über mehrere Jahre Gestalt an. Zwar hatte Gorbatschow am 18. April 1986 in Berlin verkündet: »Wir waren treue Freunde und Verbündete der (…) Deutschen Demokratischen Republik und bleiben es für alle Zeiten.« Er ließ jedoch schon einen Monat später andere Prioritäten seiner Deutschlandpolitik erkennen. Seinen Vertrauten erklärte er: »Die von uns eingeschlagene Richtung in den Beziehungen zur BRD zügelt auch die DDR.«1
Dokumentiert ist inzwischen auch Gorbatschows Auslassung im engen Kreis vom 29. September 1986: »Alle sozialistischen Länder sind angreifbar. Sie alle können verlorengehen. Die DDR ist am stärksten betroffen, einer Wiedervereinigung mit der BRD wird sie nicht widerstehen können.«2
Solche Bedenken wurden den sozialistischen Bündnispartnern vorenthalten.
Sowjetische Politiker und als Journalisten reisende Emissäre signalisierten westlichen Partnern immer häufiger die Bereitschaft der UdSSR zur Übernahme der US-amerikanischen und westdeutschen Positionen zur deutschen Frage.
In einem sowjetisch-amerikanischen Dialog im Juli 1988 in Washington trat Moskau mit der damals überraschenden These auf, »ausschlaggebend für die Einheit Europas sei die allmähliche Beseitigung der Teilung Europas und die Bildung eines geeinten deutschen Staates«.
In Gorbatschows Zukunftsvisionen war für die DDR kein Platz. Schon im Oktober 1988 machte er Bundeskanzler Kohl deutlich, dass er dessen deutschlandpolitischen Ambitionen nichts entgegensetzen werde. Bedacht auf Wahrung des Moskauer Monopols in allen Grundfragen der Innen- und Außenpolitik der Partnerländer beurteilten Gorbatschow und seine Umgebung jede Regung der DDR hinsichtlich der deutsch-deutschen Beziehungen kritisch. Der Bestand und die Zukunft der DDR waren im Moskauer Kalkül offensichtlich nur noch als Verhandlungsobjekt mit den USA und der BRD von Wert.
Gorbatschow war und blieb ein Mann mit gespaltener Zunge. Allzu oft gelang es ihm, seinem Gegenüber das Gegenteil von dem zu vermitteln, was er im Schilde führte. Am 24. November 1989 – vier Wochen nach dem Führungswechsel in der DDR – übermittelte Gorbatschow dem Vorsitzenden des Staatsrates der DDR in einem Telegramm Treubekundungen dieser Art: »Als souveräner Staat, als Mitglied des Warschauer Vertrages war und bleibt die DDR unser strategischer Verbündeter.« Drei Tage vorher hatte Gorbatschows Emissär Nikolai S. Portugalow im Bonner Bundeskanzleramt Kohls Vertrautem Horst Teltschik sieben Seiten mit aktuellen Moskauer Erwägungen für ein vereinigtes Deutschland überreicht.
 Blieb die Zwiespältigkeit der sowjetischen Politik gegenüber der DDR in Berlin verborgen?
Blieb die Zwiespältigkeit der sowjetischen Politik gegenüber der DDR in Berlin verborgen?
Sie wurde, solange der Staat existierte, offensichtlich auch von eingeweihten DDR-Bürgern nie zur Sprache gebracht. Manfred Stolpe veröffentlichte 1992 einige Informationen über den Inhalt seiner Kontakte zu sowjetischen Diplomaten (oder als Diplomaten getarnten Geheimdienstlern): »Von 1988 an sprach man mit mir mehrfach über die hypothetische Frage, ob eine demokratische DDR mit frei gewähltem Parlament, Reisefreiheit und einschneidenden wirtschaftlichen Veränderungen auch eigenständig bleiben und einen Weg wie Österreich gehen könnte. (…) Die Sowjets veranstalteten offenbar ihre Planspiele mit Ostdeutschland.«
Im Interview mit Margot Honecker erwähnte sie mal das sie und Erich Gorbatschow für einen Idioten und Verräter hielten. Naja inzwischen sieht es das russische Volk auch so und auch das deutsche Volk ist längst kein Fan mehr von Gorbi.
Gorbatschow und Bush
Gorbatschow begegnete George H. W. Bush – Vizepräsident und zuvor, 1976/1977, CIA-Chef – erstmals im März 1985 bei der Trauerfeier für Konstantin U. Tschernenko, bis zu seinem Tod Partei- und Staatschef. Das war kein Zufall. Die CIA vermutete schon seit Monaten, dass Gorbatschow die Nachfolge des verstorbenen Generalsekretärs antreten wird. Bush verließ Moskau mit innerer Zufriedenheit über diesen wichtigen Kontakt. Im Dezember 1987 trafen sich beide zum vertraulichen Gespräch in Washington.
Es war das vorletzte Jahr der Amtszeit des US-Präsidenten Ronald Reagan. Dessen Vize George H. W. Bush übernahm immer häufiger die Zügel und bereitete seinen eigenen Präsidentschaftswahlkampf vor. Während einer längeren Autofahrt fand zwischen Bush und Gorbatschow ein bedeutungsvolles Gespräch statt.
Bushs Biographen Beschloss und Talbot berichten, dass bei dieser Tour der Vizepräsident vertrauensvoll über seine Differenzen mit Präsident Reagan informierte. Aber sicher ging es nicht nur um diesen alten kranken Mann.
Gorbatschow schrieb später in seinen Memoiren: »Zum Abschluss meines Besuchs (1987) begleitete mich der Vizepräsident der USA, George Bush, zum Flughafen. Zwar hatten wir bereits Gelegenheit zum Meinungsaustausch gehabt, doch dieses ›Gespräch im Auto‹ sollte die eigentliche Basis für unsere weiteren Beziehungen schaffen. Es wurde zu einer Art Kennwort zwischen uns. Später, wenn irgendeine Frage in Anwesenheit anderer Personen mit gebotener Vorsicht besprochen wurde, pflegten Bush oder ich zu sagen: ›Ich bestätige unsere damalige Vereinbarung im Auto‹ oder: ›Die Einschätzung bleibt so wie im Auto‹«.
Zu den Tatsachen, die dieser vertrauensvollen Begegnung folgten, gehörte zweifellos eine konzertierte Aktion, die nach der Wahl Bushs zum Präsidenten der USA im Dezember 1988 zwischen Washington und Moskau begann. Alles lief dabei wie generalstabsmäßig geplant ab.
In der zweiten Januarwoche 1989 konferierte Henry Kissinger im Auftrag Bushs in Moskau mit Jakowlew und danach mit Gorbatschow. Jakowlew war für Kissinger kein unbeschriebenes Blatt. Der Russe hatte in den 1950er Jahren an der Columbia University in den USA studiert und pflegte als Botschafter der UdSSR in Kanada vielfältige Kontakte. Jakowlew stimmte am 16. Januar 1989 Kissinger auf das Gespräch mit Gorbatschow ein. Er ließ dabei »durchblicken, dass Gorbatschow und die anderen Wortführer der Reformen auf westliche Anerkennung, Ermutigung und wechselseitige Zugeständnisse angewiesen seien, um im Land Unterstützung für ihr Programm zu finden«.
Kissinger schlug Jakowlew und zwei Tage später Gorbatschow vor, USA und UdSSR sollten ein Bündel von offiziellen und informellen Übereinkünften verabschieden, die »den Handlungsspielraum der Sowjetunion bei der Sicherung ihrer Interessen in Osteuropa begrenzen und den Westen im Gegenzug verpflichten, den Umbruch im Osten« dann nicht zu beschleunigen, »wenn Moskau seine Sicherheit bedroht sähe«.
Im Januar 1989 gingen – so die Analysen international geachteter Historiker – die an diesem Deal beteiligten Politiker in Washington und Moskau von einem »Umbruch im Osten« aus und verhandelten seit diesem Treffen zwischen Kissinger, Jakowlew und Gorbatschow in der zweiten Januarwoche 1989 über das Tempo der grundlegenden Veränderungen im Osten. Als Bush am 20. Januar 1989 seine Antrittsrede als US-Präsident hielt, verkündete er in Vorabkenntnis der internen Absprachen mit Gorbatschow und in Erwartung des Kommenden:
»Die Ära des Totalitarismus ist vorüber, seine überholten Ideen sind weggeblasen.«
»Epoche geht zu Ende«
Bush wurde dann am 28. Januar 1989 von Kissinger vollständig über dessen Gespräche in Moskau informiert. Ohne Verzug sollte nun gehandelt werden. Nach einer Besprechung mit seinen engsten Mitarbeitern wurde Bushs Beraterin Condoleezza Rice mit der Zusammenstellung einer Gruppe von Osteuropaexperten beauftragt. Die USA setzten in ihrer Strategie – wie Rice erkennen ließ – auf die Schwäche Gorbatschows. Lange Zeit danach offenbarte sie im Spiegel-Interview »Es ging um den Jackpot« vom 27. September 2010 das Kalkül: »Im Weißen Haus hat nie jemand über die Option einer deutschen Wiedervereinigung ohne deutsche NATO-Mitgliedschaft nachgedacht. (…) Die Russen waren so durcheinander, dass sie gar nicht wussten, was ihre Interessen waren. (…) Das Zeitfenster war so eng – die Russen mussten stark genug sein, um ihre Rechte abtreten zu können. Aber sie durften auch nicht so stark sein, dass sie den Prozess aufhalten können.« Im selben Heft wird auch deutlich, dass die US-Strategen nichts von einem möglichen Zusammenschluss beider deutschen Staaten hielten. Ihre Vorstellung von der Einheit Deutschlands verbanden sie von vornherein mit einem »Staat nach westdeutschem Zuschnitt«. Rice: »Ich sah die Einheit eher wie eine Übernahme.« Mit dem vereinigten Deutschland, eingebettet in die NATO, war »Amerikas Einfluss in Europa (…) gesichert«. Darum ging es. Nicht um Rede-, Reise- oder sonstige Freiheiten. Es ging um den Vormarsch des kapitalistischen Westens nach Osten und um die Sicherung des Einflusses der USA und der NATO in Europa!
Nach der Strategieberatung im Februar 1989 wurde in Washington fieberhaft an einer Direktive für die Präzisierung der Politik der USA gegenüber der UdSSR und den Ländern Osteuropas gearbeitet. Das 31 Seiten umfassende Dokument des Nationalen Sicherheitsrates der USA erhielt die Bezeichnung »NSR-3«. Auch wenn es in diesem Papier hieß, dass man die Perestroika unterstütze, ging es allein darum, »die Sowjets in einer Weise herauszufordern, die sie zwingt, die Richtung einzuschlagen, die wir wünschen«.
Zur Wunschliste der im Dokument formulierten Veränderungen in der UdSSR gehörten »institutionell verankerte Garantien für bürgerliche, politische und wirtschaftliche Freiheiten; liberale Gesetze und eine liberale Wahlpraxis (…); eine unabhängige Rechtsprechung; eine kritische Presse; florierende nichtstaatliche Organisationen; größere Bewegungsfreiheit; Fortschritt in Richtung auf größere wirtschaftliche Freiheiten durch dezentrale Entscheidungsfindung; das Recht auf privaten Land- und Kapitalbesitz; ein Ende der Kommandowirtschaft; ein Ende des Monopols der kommunistischen Partei und die Abschaffung des Polizeistaats«.
War es Zufall, dass diese Formulierungen wenige Monate später, wenn auch mit partiellen Modifikationen, in den Losungen der Bürgerrechtsbewegungen und den Forderungen der Parteioppositionen in allen sozialistischen Ländern auftauchten? Bushs Sicherheitsberater Brent Scowcroft erklärte nach Erlass von NSR-3 am 24. März 1989 auf einer Tagung des Nationalen Sicherheitsrates, »dass zum ersten Mal die Gelegenheit gekommen sei, das zu vollbringen, wovon frühere Präsidenten nur hätten träumen können – Osteuropa in den Schoß des Westens zurückzuführen«.
Gorbatschows außenpolitischer Sonderberater Anatoli Tschernjajew lieferte die russische Version der Einschätzung des gleichen historischen Vorgangs. Er vertraute am 10. November 1989 seinem Tagebuch die Mitteilung an: »Die Berliner Mauer ist gefallen. Eine ganze Epoche in der Geschichte des ›sozialistischen Systems‹ ist zu Ende gegangen (…). Denn hier geht es schon nicht mehr um ›Sozialismus‹, sondern um eine Veränderung des Kräfteverhältnisses in der Welt, hier ist das Ende von Jalta (der Konferenz der Repräsentanten der UdSSR, der USA und Großbritanniens zur Regelung von Grundfragen der Nachkriegsordnung im Februar 1945; H. G.). (…)
Das ist, was Gorbatschow angerichtet hat. Er hat sich als wahrhaft groß erwiesen (…).«
1 Michail Gorbatschow: Ansprache auf dem XI. Parteitag der SED, Protokoll der Verhandlungen …, Berlin 1986, S. 153
2 Michail Gorbatschow und die deutsche Frage. Sowjetische Dokumente 1986–1991. Hg. von Alexander Galkin und Anatoli Tschernjajew, München 2011, S. 6




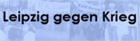


Diskussionen
Es gibt noch keine Kommentare.