monopoli
Da wir hier öfter mal über die USA sprechen, was angesichts ihrer Rolle in der Welt immer wieder vorkommt,
haben wir uns entschlossen, diese Arbeit aus dem Blog USA erklärt zu übernehmen. Da diese jedoch dort etwas schwer zu überblicken ist, haben wir sie als Serie ins Menü Amerika aufgenommen. Wir finden, das sollte man wissen, bevor man über die Amerikaner richtet.
Wir danken dem Autor für die Übernahme und die fantastische Arbeit und empfehlen jedem, der die Amerikaner verstehen will, sich unbedingt diesen Blog anzuschauen. Seitdem wir den gelesen haben, sehen wir einiges anders und das wollten wir euch weitergeben.
Amerikanische Wahlen
Warum es in den USA Vorwahlen gibt
Es ist 2008, das ist ein grades Jahr, und damit ein Wahljahr in den USA, wo die Termine wie ein Uhrwerk eingehalten werden. Einige Themen wie die Vor- und Nachteile der Mehrheitswahl haben wir schon 2006 abgehandelt. Aber diesmal wird nicht nur das ganze Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats gewählt, sondern auch der Präsident. Das heißt, es gibt Dinge wie Vorwahlen (primaries). Dabei bestimmen die Parteien, wer ihr Kandidat im November sein soll.
Vorwahlen sind laut, teuer, nervig und sorgen dieses Mal dafür, dass der Wahlkampf fast ein Jahr dauert. Warum tun sich die Amerikaner so etwas an?
Zuerst: Die Verfassung kann nichts dafür. Schauen wir nach, was dort über die Wahl des Präsidenten steht, finden wir in Artikel 2 lediglich:
Each State shall appoint, in such Manner as the Legislature thereof may direct, a Number of Electors, equal to the whole Number of Senators and Representatives to which the State may be entitled in the Congress […].
Und etwas weiter unten:
The Congress may determine the Time of chusing the Electors, and the Day on which they shall give their Votes; which Day shall be the same throughout the United States.
(Das chusing ist eine alternative Schreibweise von choosing, die damals gängig war, die man seinem Englischlehrer aber heute nicht mehr anbieten sollte. Die erste Version der Verfassung wurde in großer Eile per Hand geschrieben und enthält tatsächlich einige Fehler.)
Nix mit Vorwahlen. Das muss irgendein neumodischer Schnickschnack sein.
Wir können aus Artikel 2 einen Punkt mitnehmen, der immer wieder zu Verwirrung führt und so zentral für das Verständnis des Systems ist, dass wir heute einmal zum visuellen Hammer greifen:
In den USA wird der Präsident nicht durch eine Wahl auf Bundesebene bestimmt, sondert durch getrennte Wahlen in den einzelnen Bundesstaaten, deren Ergebnisse kombiniert werden.
Daher organisiert nicht der Bund die Wahl (oder die Vorwahlen), sondern die einzelnen Bundesstaaten; daher gibt der Bundesstaat New York sein Endergebnis schon bekannt, während in Kalifornien noch gewählt wird; daher ist der genaue Ablauf der Wahl in jedem Bundesstaat anders, wie wir 2000 gesehen haben. Die Einzelheiten folgen in einem späteren Eintrag.
Zurück zu den Vorwahlen –
(Zwanghafte Browser-Suchfunktion-Benutzer werden bemerkt haben: Das Wort primary kommt doch in der Verfassung vor, im 24. Verfassungszusatz. Dort steht, dass man für die Teilnahme an einer Wahl keine poll tax verlangen darf. Als Teil der Jim Crow laws führten einige Südstaaten nach dem Bürgerkrieg Wahlgebühren ein. Erlassen wurden sie nur dem, der zeigen konnte, dass ein Vorfahre vor dem Bürgerkrieg wählen durfte. Durch diesen Trick wurde die Masse der Schwarzen trotz des 15. Amendement von der Wahl ausgeschlossen.)
– ihre Funktion wird deutlich, wenn man sich klar macht, dass es sich um parteiinterne Wettbewerbe handelt. Deswegen stehen sie auch nicht in der Verfassung, denn Parteien sind im amerikanischen System nicht vorgesehen. Die Gründungsväter hielten sie für eine Form von politischem Krebs. Allerdings bieten Parteien, selbst die der schwächlichen amerikanischen Variante, jede Menge Vorteile. Nur George Washington als erster Präsident war parteilos. Inzwischen gelten Parteien als unvermeidbares Übel.
Dumm für eine amerikanische Partei ist aber, dass in den USA Menschen gewählt werden. Damit könnten gleich mehrere ihrer Mitglieder im Kampf um die Präsidentschaft antreten. Man stelle sich vor, im November würden nicht entweder Hillary Clinton oder Barack Obama für die Demokraten kandidieren, sondern beide. Das würde die Wählerschaft der Partei spalten und der lachende Dritte wäre der Kandidat der Republikaner.
Die Parteien brauchen also einen Mechanismus, um sich auf einen einzigen, gemeinsamen Kandidaten zu einigen.
Früher, viel früher, geschah das in den Hinterzimmern des Kapitols. Von etwa 1796 bis 1824 kamen die Abgeordneten der beiden großen Parteien – damals die Federalists und die Democratic-Republicans – in ihren congressional caucus zusammen und handelten jeweils ihren Kandidaten aus. Die Treffen waren zunächst geheim. Als undemokratisch verschrien (“King Caucus”), zerfiel das System 1824 im Streit.
Stattdessen wurden die landesweiten Parteitage (national conventions) eingeführt, die es – wenn auch in stark abgewandelter Form – bis heute gibt. Die Demokraten fingen 1832 damit an, die 1854 gegründeten Republikaner zogen nach. Die Parteien in jedem Bundesstaat bestimmten die Delegierten.
(Wie wenig die amerikanischen Parteien mit ihren deutschen Namensvettern zu tun haben, sieht man daran, dass die Demokraten erst nach dem Parteitag 1848 überhaupt eine landesweite Struktur bekamen. Das Democratic National Committee (DNC) bezeichnet sich selbst als die älteste noch bestehende politische Organisation der Welt.)
Damals waren die Parteitage noch wichtig, denn dort fiel die Entscheidung. Getroffen wurde sie allerdings von den Parteibonzen. Es gab hitzige Intrigen in verrauchter Luft, endlose Verhandlungen und dutzende Abstimmungen. Am Ende gewannen schon mal die dark horse candidates wie James K. Polk, der erst auf dem Parteitag ins Spiel gebracht wurde. Das Verfahren hielt sich etwa 140 Jahre lang, war aber weder transparent noch demokratisch.
Einige Bundesstaaten fingen daher im 19. Jahrhundert an, richtige Wahlen abzuhalten, die ersten primaries. Dort entschied die Basis, welche Delegierte zu dem Parteitag geschickt wurden und wie sie dort abzustimmen hatten. Allerdings blieb der Einfluss dieser “echten” Vorwahlen auf das Gesamtverfahren zunächst begrenzt.
Wie begrenzt? Auf dem Parteitag der Demokraten 1968 in Chicago wurde Hubert Humphrey Kandidat, ohne eine einzige Vorwahl gewonnen zu haben (er wurde später von Richard Nixon geschlagen). Das machte eine Menge Leute wütend. In der aufgeladenen Atmosphäre vor dem Hintergrund des Vietnam-Kriegs kam es in Chicago zu Krawallen. Auf den Schock hin wurden flächendeckend Vor- und Urwahlen eingeführt, deren Ablauf von den Bundesstaaten gesetzlich geregelt wird.
Heute findet dort die Entscheidung statt: Wer die meisten Stimmen bekommt, schickt Delegierte zu den Parteitagen, die für ihn stimmen. Meist steht der Kandidat aber schon lange vorher fest.
Die Parteitage sind dadurch zu einer reinen Krönungszeremonie degeneriert, eine Riesenshow mit lebensgefährlichen Konfetti-Blizzards und manisch lächelnden Menschen, die man sonst nur in Raccoon City trifft. Da die inhaltliche Bedeutung der Veranstaltung gegen Null tendiert, berichten die US-Sender auch nicht mehr großartig über sie. Das wiederum treibt die deutschen Medien zur Verzweiflung, die den Umbau des Vorwahl-Systems in den 70er Jahren verpasst haben und den Amerikanern prompt wieder politisches Desinteresse unterstellen.
Kurz gesagt lautet die Antwort also: Durch das System der Vorwahlen entscheidet die Basis, wer der Kandidat der Partei wird.
Eine Parallele zu Deutschland ist schwierig, denn hier gibt es weder eine eigenständige Exekutive noch hat der Titel “Kanzlerkandidat” eine juristische Bedeutung. Der interessierte Leser mag sich jedoch angesichts der “Amerikanisierung” (gemeint ist die Personalisierung) des deutschen Wahlkampfs vorstellen, dass die Mitglieder der SPD darüber abstimmen könnten – verbindlich – wer ihr Kandidat wird. Tatsächlich gibt es immer mal wieder die Forderung nach Vorwahlen in Deutschland, ausdrücklich nach dem US-Vorbild. Ob das wirklich sinnvoll wäre, ist nicht Thema dieses Blogs.
Das heutige System in den USA hat noch einen weiteren nützlichen Effekt. Ein Kandidat der Parteiführung aus dem Hinterzimmer mag beim Wähler nicht ankommen. Im Extremfall weiß keiner, wer das überhaupt ist – Who is James K. Polk? spotteten die Whigs nach dem Parteitag der Demokraten 1844 (dass Polk trotzdem gewann, sollte Kurt Beck ein Trost sein). Aber wenn die Leute, die die Partei wählen werden, auch gleich selbst den Kandidaten bestimmen können, erhöht das die Siegeschancen ungemein. Auch deswegen gibt es die Vorwahlen.
Der logische nächste Schritt dieser Entwicklung sind die open primaries wie sie in einigen Bundesstaaten praktiziert werden. Dort kann sich jeder aussuchen, an welcher Vorwahl er teilnimmt. Auch ein Parteimitglied der Demokraten kann also bei den Vorwahlen der Republikaner seine Stimme abgeben und damit den schwächsten (!) Kandidaten fördern. Dieser Vorgang wird als raiding bezeichnet, funktioniert aber nicht wirklich. Häufiger sind ohnehin closed primaries, also parteiinterne Vorwahlen.
Wir werden uns die verschiedenen Formen von Vorwahlen, insbesondere den Unterschied zwischen primary und caucus, in einer der nächsten Folgen anschauen. Der Eintrag wird deutlich kürzer, denn am Ende läuft es auf Tabellen [PDF] hinaus.
Was die Ausgaben im US-Wahlkampf mit Störchen zu tun haben
Für unseren heutigen Eintrag müssen wir uns etwas mit der Statistik befassen. Keine Angst, das wird nicht weh tun: Wir schaffen das!
Es geht auch nur um ein einfaches, sehr grundsätzliches Prinzip: Um den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität.
Eine Korrelation liegt vor, wenn zwei Ereignisse A und B gleichzeitig auftreten. Eine Kausalität besteht dagegen, wenn ein Ereignis die Folge des anderen ist. A ist dann die Ursache von B (oder B von A).
Soweit alles klar? Dann kommen wir zu dem Prinzip:
Eine Korrelation ist kein Beweis für eine Kausalität.
Nur weil A und B gleichzeitig auftreten, heißt das nicht, dass B die Folge von A ist (oder A die Folge von B). Es kann so sein, aber man muss es getrennt nachweisen.
Also. Dass gleichzeitig die Zahl der Störche und die Geburtenrate in Deutschland zurückgegangen sind, bedeutet also nicht, dass Babys wirklich von Vögeln gebracht werden. Hier haben wir den häufigen Fall, dass A und B beide von einem dritten Faktor abhängen: Die Industrialisierung (im weitesten Sinne).
Vielleicht ist das gemeinsame Auftreten aber nur ein Zufall. Dass der Aktienkurs von Apple immer weiter steigt, je mehr Hefte von Buffy Staffel 8 auf den Markt kommen (inzwischen mehr als eine Million, übrigens), dürfte nicht zusammenhängen. So groß ist die Kaufkraft dieses Autors auch nicht.
Schließlich können Dinge, die gleichzeitig auftreten, tatsächlich voneinander abhängen. Dass alles im Hause Stevenson unter dem Sofa verschwindet, seitdem Kind Nummer Zwei krabbeln kann, folgt eindeutig dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Als Nachweis dienten über Weihnachten die Schokoladenspuren, die die Staubmäuse so schön an den Fernbedienungen binden.
Und das war es schon mit der Statistik.
Wir mussten diesen Ausflug einschieben, weil er für die Berichterstattung über die amerikanische Wahlkampffinanzierung wichtig ist: Große Teile der deutschen Presse sind mit dem Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität offensichtlich überfordert. Dies ist einer der Einträge, die sehr von Regel 2 dieses Blogs profitieren, denn dieser Autor neigt bei der Diskussion über das Thema sonst zu Hohn, Spott und Sarkasmus.
Hintergrund ist die Tatsache, dass die Gewinner in den USA in der Regel mehr Geld für ihren Wahlkampf ausgegeben haben als die Verlierer. Das steht überhaupt nicht in Frage, war schon immer so und wird bei jeder Wahl bestätigt. Der durchschnittliche Sieger im Senat gab 2006 9,6 Millionen Dollar aus, der durchschnittliche Verlierer 7,4 Millionen (das Repräsentantenhaus ist übrigens billiger, da machte ein Abgeordneter mit 182.000 Dollar das Rennen. Die Diskussion über die absoluten Beträge führen wir in einem späteren Eintrag).
Der Zusatz “in der Regel” ist wichtig, denn es gibt genug Beispiele für den umgekehrten Fall: Weniger ausgegeben, aber trotzdem gewonnen. Beim Kampf um einen Senatssitz in Oklahoma 2004 – um ein anderes Jahr zu nehmen – gab der Demokrat Brad Carson 4,5 Millionen Dollar aus und verlor trotzdem gegen den Republikaner Tom Coburn mit seinen drei Millionen Dollar, immerhin ein ganzes Drittel weniger. Mehr Geld ist in den USA keine Garantie für einen Wahlsieg. Alles andere wäre in zwei Jahrhunderten Demokratie auch irgendwie aufgefallen.
Was sich die meisten Deutschen nun nicht bewusst machen: Das alles ist in der Bundesrepublik genau so.
Die entscheidende Einheit ist zwar die Partei und nicht die Einzelperson, der Maßstab nicht der gewonnene Sitz sondern der Prozentsatz der Wählerstimmen und ein großer Teil des Geldes kommt über die Parteifinanzierung statt über Spenden. Aber wenn wir uns die Wahlkampfausgaben für die Bundestagswahl 2005 anschauen, ist am Ende der Trend so eindeutig wie in den USA: Die Sieger haben grundsätzlich mehr ausgegeben.
Partei Ausgaben (Euro) Stimmanteil (%)
Union 23,0 Mio 35,2
SPD 25,0 Mio 34,4
FDP 3,5 Mio 9,8
PDS 4,0 Mio 8,7
Grüne 3,8 Mio 8,1
(Da die Wahl 2005 kurzfristig angesetzt wurde, könnte das ein Sonderfall sein. Den Zusammenhang finden wir aber auch 2002.)
Was uns zu der Frage bringt, ob es in Deutschland nur am Geld liegt. Spielen wir Was-Wäre-Wenn: Wäre die PDS mit 20 Millionen Euro auch auf ein Drittel der Stimmen gekommen? Wäre die SPD unter zehn Prozent der Stimmen gelieben, wenn sie nur vier Millionen Euro gehabt hätte? Ist der Wahlausgang in Deutschland etwa käuflich?
Wer jetzt den Kopf schüttelt oder lacht, muss sich klar machen, dass genau diese Behauptung ständig über Wahlen in den USA gemacht wird: Wer gewinne, hänge vom Geldbeutel ab, so die Unterstellung, frei nach dem Motto: “Hast Du was, wirst Du was.”
In den USA ist das genauso albern wie in Deutschland, denn jetzt kommen wir zu dem Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. In beiden Staaten gibt es eine starke und unbestrittene Korrelation zwischen Wahlkampfausgaben und Stimmenzahl – die Gewinner hatten mehr Geld. Eine Kausalität ist allerdings nicht gegeben. Vielmehr hängt es in beiden Systemen von einem dritten Faktor ab: Der Beliebtheit. Wer beliebt ist, erhält mehr Geld und mehr Stimmen.
Der Mechanismus dafür ist in den USA direkter als in Deutschland, denn die amerikanischen Kandidaten müssen beim Spendensammlen in jedem Wahlkampf wieder bei Null anfangen. Die deutschen Parteien erhalten dagegen mehr Geld vom Staat, je besser sie in der vergangenen Wahl abgeschnitten haben. Für Amerikaner ist das undenkbar – man stelle sich vor, der republikanische Spitzenkandidat würde mehr Geld bekommen als der demokratische, nur weil George W. Bush jetzt Präsident ist. Aus US-Sicht gibt das deutsche System dem Sieger der vergangenen Wahl einen unfairen Startvorteil bei der nächsten.
Den Nachweis der fehlenden Kausalität liefert uns in diesem Jahr Mike Huckabee im Vorwahlkampf der Republikaner. Im Dezember 2007 lag er bei den Spenden mit 2,3 Millionen Dollar dramatisch hinter Mitt Romney (62,8 Mio) und Rudy Giuliani (47 Mio). Nach der “Hast Du was, wirst Du was”-Theorie hätte er sich gleich erschießen können. Im selben Monat sprangen aber seine Umfragewerte landesweit auf 22 Prozent und damit nur einen Prozentpunkt hinter dem Favoriten Giuliani. Und tatsächlich gewann Huckabee im Januar die Urwahl in Iowa mit deutlichem Vorsprung.
In gewisser Weise tun beide Systeme das Gleiche: Sie entziehen den Verlierern Geld. In den USA sind das insbesondere die Spenden, die bei fallender Beliebtheit noch im Laufe des Wahlkampfs versiegen. In Deutschland ist es Geld des Steuerzahlers, das für die nächste Wahl nicht mehr zur Verfügung steht. Am Grundgedanken ändert sich nichts.
Nachdem wir das – mit einem Minimum an Sarkasmus, eigentlich – aus dem Weg geräumt haben, können wir uns in den kommenden Einträgen etwas entspannter mit dem Thema Geld befassen. Warum ist der amerikanische Wahlkampf vergleichsweise teuer, und ist er es wirklich? Der interessierte Leser kann schon mal vorarbeiten: Wie teuer ist eigentlich eine Bundestagswahl, wenn man alles zusammenrechnet?
Der Ablauf der Vorwahlen
Nachdem wir uns das “Warum” der Vorwahl angeschaut haben, geht es heute um das “Wie”.
Wir werden versuchen, es kurz zu halten, denn der Komplexitätsgrad wird sehr schnell sehr hoch. Außerdem mangelt es in diesem Jahr nicht an Erklärungen in den Medien und anderen Blogs. Zum Teil wird dort auch Alice in Wunderland eingebaut – so muss das sein.
Meistens gehen die Beschreibungen von dem Ablauf einer Vorwahl aus und verfolgen dann chronologisch, was mit den Stimmen geschieht. Wir ziehen das Ganze dagegen von hinten auf und fangen mit den Parteitagen an, den national conventions.
Wie schon beschrieben wurde dort früher der endgültige Präsidentschaftskandidat auf mehr oder weniger fragwürdige Art bestimmt. Heute wählt die Parteibasis in jedem Bundesstaat Delegierte, die einem der Bewerber verpflichtet sind. Wie viele Vertreter jeder Bundesstaat schickt, entscheidet dabei die Partei. Wer die meisten Delegiertenstimmen auf sich vereinigt, hat gewonnen.
Lassen wir das allgemeine Geschwätz und schauen uns die Zahlen an.
Die Demokraten haben 4.049 Delegierte, die sich vom 25. bis zum 28. August in Denver, Colorado treffen. Davon sind 3.253 pledged delegates, die verpflichtet sind, ihre Stimme für einen bestimmten Kandidaten abzugeben. Zudem gibt es 796 superdelegates – Senatoren, Gouverneure, Parteichefs – die nicht an einen Bewerber gebunden sind.
(Die Sache mit den Superdelegierten gehört zu den Dingen, die kompliziert werden können. Sollten sie im Laufe des Wahlkampfs wichtig werden, greifen wir diese Leute in einem eigenen Eintrag auf.)
Die Republikaner haben weniger Delegierte, nämlich 2.380. Sie kommen vom 1. bis zum 4. September in Minneapolis-St. Paul, Minnesota zusammen. Neben den 1.917 pledged delegates gibt es 463 unpledged delegates.
Für jeden Bundesstaat kann man im Internet nachschlagen, wie viele Delegierte er für welche Partei schickt, wie viele davon gebunden sind und wie das Verfahren dort genau abläuft. Da wäre zum Beispiel Iowa, wo am 3. Januar die erste Vorwahl in Form eines caucus stattfand. Bei den Demokraten wurden insgesamt 57 Delegierte vergeben, darunter zwölf Superdelegierte. Bei den Republikanern waren es 40 Delegierte, von denen drei nicht gebunden sind. Oder New Hampshire mit der Vorwahl am 8. Januar: 27 Delegierte für die Demokraten, davon fünf Superdelegierte, und zwölf Delegierte für die Republikaner, alle gebunden.
(Der aufmerksame Leser wird bei den Links etwas entdeckt haben, das uns in den USA bislang nicht begegnet ist: Die Delegierten werden nicht nach dem Prinzip der Mehrheitswahl (winner-takes-all) verteilt, sondern nach dem Verhältnis der Stimmen. Bei den Republikanern wurden in New Hamsphire John McCain sieben Delegierte zugesprochen, Mitt Romney vier und Mick Huckabee einer. Das können die Amerikaner also auch, wenn sie wollen. Allerdings wollen sie meist nicht, wie wir besprochen haben. Wir kehren beim Wahlkolleg zu dem Thema zurück.)
Jetzt zählt man während der Vorwahlen Bundesstaat für Bundesstaat bei den Republikanern und Demokraten jeweils die Delegierten zusammen, bis jemand die Mehrheit hat. Der Sieger wird dann bei den Parteitagen offiziell ausgerufen, nur dass keine Sau hinguckt, weil die Entscheidung schon gefallen ist.
Drei Dinge sind noch wichtig:
Die ersten Bundesstaaten wie Iowa und New Hampshire schicken eigentlich nur wenige Delegierte. Ihre übermäßige Bedeutung liegt darin, dass Tendenzen klar werden und die ganz Hoffnungslosen danach aufhören.
Eine Vorentscheidung wird beim Super Tuesday getroffen (auch Super Duper Tuesday genannt). Dabei werden in diesem Jahr am 5. Februar in mehr als 20 Bundesstaaten die Vorwahlen abgehalten.
Das Wahlverfahren ist in jedem Bundesstaat anders – daher der Hinweis auf die Tabellen [PDF].
Wir sind wieder am Anfang: Wie eine Vorwahl in der Praxis abläuft. Um nicht völlig wahnsinnig zu werden, sollte man sich auf die zwei grundsätzlichen Arten von Vorwahlen beschränken: Den causus (Urwahl oder Wahlversammlung) und die primary (Vorwahl im engeren Sinne).
Die Primary ist am einfachsten: Es ist eine ganz normale Wahl mit Stimmzetteln (oder Wahlmaschinen) und Wahllokalen, die den ganzen Tag geöffnet sind, also alles nicht grundsätzlich anders als eine Abstimmung in Deutschland. Das ist die häufigere Form. Wir hatten den Unterschied zwischen “offenen” und “geschlossenen” Primaries schon besprochen.
Dann gibt es die Urwahl. Der Ablauf ist radikal anders und für Deutsche fremdartig. Schauen wir uns die Demokraten in Iowa an, weil die Urwahl dort von den Medien eng begleitet wird und es ein besonders aufwändiges Verfahren ist:
Die Teilnehmer kommen am Abend in ihrem Landkreis in kleinen Gruppen in Schulen, Turnhallen und Wohnzimmern zusammen und diskutieren über die Kandidaten. Dann kommt der erste Wahldurchgang: Die Anhänger eines Bewerbers stehen gemeinsam auf – keine Stimmzettel, keine geheime Wahl. Kandidaten, die weniger als 15 Prozent bekommen, werden gestrichen. Es folgt wieder eine Diskussionsphase. Hier versucht jeder, die Anhänger des anderen Lagers umzustimmen. Oder wie ein Clinton-Anhänger es beschrieb:
You hit that floor and work it and try to get them. It’s like a fun game.
Dann kommt der zweite und letzte Wahlgang.
Die Urwahl in Iowa ist, wie man sich vorstellen kann, umstritten. Kritiker sehen einen viel zu großen Einfluss von gewieften Rednern und von örtlichen Parteibonzen. Die Beteiligung ist vergleichsweise gering: Die Demokraten haben in diesem Jahr mit 240.000 Teilnehmern einen Rekord aufgestellt, aus einer Bevölkerung von drei Millionen. Und, mal ehrlich, eine nicht-geheime Wahl? Im 21. Jahrhundert?
Qualität vor Quantität, sagen die Befürworter. Auf diese Weise, so ihr Argument, beschäftigen sich die Teilnehmer sehr viel intensiver mit den Kandidaten und ihren Programmen. Das Verfahren geht über Stunden und jeder muss sich offen zu seiner Entscheidung bekennen, vor seinen Nachbaren, Freunden und seiner Familie. Da überlegt man es sich gut, wer die Stimme kriegt und vor allem warum. Hier kommt man nicht damit durch, kurz in eine Wahlkabine zu huschen und irgendwo ein Kreuz hinzuschmieren. Der Wähler muss sich in den Prozess einbringen.
Die guten Bürger des Agrarstaats beanspruchen daher für sich eine Leitfunktion bei den Präsidentenwahlen. Dass ein Sieg in ihren Maisfeldern nicht zwingend einen Sieg in ganz Amerika vorhersagt, stört sie dabei nicht wirklich, auch wenn ihre Landsleute schon mal die Augen verdrehen.
Die verschiedenen Abläufe der Vorwahl in den Bundesstaaten sind nicht nur für den politischen Beobachter aus Übersee eine Herausforderung. Auch die Kandidaten und ihre Wahlkampf-Organisationen sind gezwungen, sich von Bundesstaat zu Bundesstaat umzustellen. Es ist, wenn man so will, ein Teil der Prüfungen, die ein zukünfigter Präsident meistern muss: Wer mit der Vielfalt nicht klar kommt, scheitert.
Das Gleiche gilt auch für die körperlichen und psychischen Belastungen der Vorwahlen, die auf Europäer extrem wirken. Ohne ungalant gegenüber der teilnehmenden Dame wirken zu wollen, müssen wir festhalten: In diesem Jahr sahen die Kandidaten schon vor Iowa erschöpft aus. Die Bewerber müssen zeigen, dass sie den Druck aushalten können, über Monate hinweg. Wie es Amtsinhaber George W. Bush kürzlich mit einer gewissen Nostalgie formulierte:
The testing that takes place in the primary is part of conditioning somebody to be able to deal with the pressures of the office
Das klassische Beispiel der Neuzeit ist der “Dean Scream” [YouTube] des demokratischen Bewerbers Howard Dean beim Vorwahlkampf 2004 in Iowa. Ob von den Medien hochgespielt oder nicht, Dean hatte sich einen Moment nicht unter Kontrolle und – wham! – war sofort draußen. Wer Präsident der USA werden will, kann sich so einen Ausrutscher nicht erlauben. Nur die Harten kommen in den Rosengarten.
Allerdings haben wir in diesem Jahr einen wichtigen Sonderfall erlebt: Man sollte schon zeigen, dass man grundsätzlich zu menschlichen Regungen fähig ist. Das finden die Wähler dann wieder gut.
Angewandte Urwahl-Taktik am Beispiel von West Virginia
Vor wenigen Stunden hat der Super Tuesday begonnen, der Tag, an dem in 24 Bundesstaaten Vorwahlen abgehalten werden. Am Dienstagabend deutscher Zeit haben wir auch schon das erste Ergebnis: In West Virginia hat Mike Huckabee bei den Republikanern den caucus gewonnen.
WTF, werden jetzt einige interessierte Leser denken. Huckabee? Der Baptistenprediger? War der nicht in Umfragen weit abgeschlagen? Sollte nicht John McCain oder Mitt Romney das Rennen machen?
Ja, schon. Aber es handelte sich in West Virginia nicht um eine primary im engeren Sinn, also eine Vorwahl nach dem Muster der normalen Wahl, sondern um eine Urwahl – das waren die Diskussionsrunden in Turnhallen und Wohnzimmern, wie in Iowa. Und dabei kommen Wahltaktiken ins Spiel, die Einige faszinierend und Andere entsetzlich finden. Huckabees Sieg gibt uns die Gelegenheit, sie am lebenden Beispiel zu sehen.
Für einen Sieg waren 50 Prozent der Stimmen nötig, sonst gab es eine neue Runde.
Schauen wir uns den ersten Durchgang an:
Kandidat vH Stimmen
Romney 41
Huckabee 33
McCain 16
Paul 10
Niemand hat auf Anhieb gewonnen, es gibt also eine zweite Runde. Romney liegt vorne. Ron Paul hat so wenige Stimmen, dass er ausscheidet. McCain dürfte nicht aus eigener Kraft gewinnen können.
Nach einer Beratungspause ging die zweite Runde so aus:
Kandidat vH Stimmen
Huckabee 52
Romney 47
McCain 1
Huckabee hat plötzlich mehr als 50 Prozent der Stimmen und gewinnt. McCain ist völlig abgestürzt. Was ist passiert?
Den Anhängern von McCain war nach dem ersten Wahlgang klar, dass sie den Bundesstaat nicht würden gewinnen konnten. Sie haben also das Nächstbeste getan und dafür gesorgt, dass Romney – der wirkliche Gegner in der Vorwahl – auch keine Delegierten bekommt, denn in West Virginia gilt das Mehrheitswahlrecht (winner takes all). Sie haben für Huckabee gestimmt.
Am Ende ist das Ergebnis also kein Sieg für Huckabee sondern eine Niederlage für Romney. Der hatte in West Virginia richtig Wahlkampf geführt, während McCain seine Ressourcen – Zeit und Geld – anderswo einsetzte. Romney liegt zu diesem Zeitpunkt insgesamt zurück und braucht eigentlich jeden einzelnen Delegierten.
Für die McCain-Anhänger ist seine Niederlage fast so gut wie ein eigener Sieg, weswegen sie in den Kneipen von Charleston heute Nacht wohl ständig “Country Roads” von John Denver gröhlen werden:
Almost heaven, West Virginia
Ja, aber was hat das Ergebnis mit dem Wählerwillen zu tun, mag sich der interessierte Leser jetzt fragen. Nicht viel. Romney hatte wohl die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Deswegen sind Urwahlen die Ausnahme und nicht die Regel bei Vorwahlen. Deswegen machen sie den Parteitaktikern aber auch so viel Spaß.
Am Ende muss man festhalten: West Virginia hat mit 1,8 Millionen Einwohnern etwa so viele wie Hamburg und stellt aus dieser Wahl gerade 18 Delegierte von 2380 – also nicht einmal ein Prozent. Die nächsten Abstimmungen in den großen Bundesstaaten, das werden in den kommenden Stunden die wirklich spannenden sein.
Wahlkampf ohne Gegner und die Weisheit der Matrix
Auch wenn es in den Medien, deutschen wie amerikanischen, im Moment untergeht: Im November wird nicht nur der Präsident gewählt, sondern auch der Kongress, genauer gesagt, das ganze Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats.
Wir wollen uns heute das Repräsentantenhaus anschauen, wo – wie alle zwei Jahre – sämtliche 435 Sitze zur Wahl stehen. Besonders dort kommt es zu einem Phänomen, das der interessierte Leser vielleicht nicht erwartet: In einigen Wahlbezirken tritt nur ein Kandidat der beiden großen Parteien an. Der Bürger kann nicht zwischen einem Demokraten und einem Republikaner wählen, sondern meist nur zwischen einem Kandidaten einer der großen Parteien und mehreren der kleineren wie den Grünen oder den besagten Libertarians.
Gehen wir von den Demokraten aus, weil das pro-demokratische Blog Daily Kos diese Rennen eng verfolgt und wir seine Daten klauen zitieren können. Nach diesen Angaben gibt es elf Wahlbezirke, in denen ein Republikaner und kein Demokrat antritt:
AL-06 – R+25
AR-03 – R+11
CA-19 – R+10
CA-22 – R+16
KY-05 – R+8
TX-01 – R+17
TX-02 – R+12
TX-05 – R+16
TX-11 – R+25
TX-14 – R+14
TX-21 – R+13
Die ersten beiden Buchstaben sind die Abkürzungen für den Bundesstaat – die vielen “TX” stehen zum Beispiel für “Texas”. Die Zahl dahinter ist die des Wahlkreises. So gehört zu TX-14 die Stadt Galveston. Die Sache mit dem “R” erklären wir gleich.
Bleiben wir bei TX-14. Dort treten an (bei den letzten drei war nicht sofort eine eigene Website zu finden):
Ron Paul, der jetzige republikanische Abgeordnete
Chris Peden, ein republikanischer Herausforderer
Eugene Flynn, ein Libertarian
James Harvey, parteilos
Gregory Roof, parteilos
(Ron Paul? Kennen wir den nicht? Genau, das ist einer der Bewerber für die Präsidentschaft, weswegen er eine zweite Website hat. Paul ist formell sogar noch im Rennen, auch wenn ihn die Presse ignoriert. Peden war angetreten für den Fall, dass Paul aussteigt.)
Ein Demokrat ist nicht darunter. Warum? Zwei Gründe.
Der erste sind die Zahlen nach dem Buchstaben “R” in der Liste. Das ist der partisan voting index nach Cook, kurz PVI genannt. Er beschreibt, vereinfacht gesagt, um wie viele Prozentpunkte die Partei (“R” für Republikaner, “D” für Demokraten”) in einem Wahlbezirk besser als im Landesdurchschnitt abschneidet.
Das “R+25″ für TX-11 besagt, dass die Republikaner dort 25 Prozentpunkte mehr Stimmen bekommen. Für jeden Demokraten wäre eine Bewerbung dort ein politisches Selbstmordkommando. Das R+14 für TX-14 ist in der Praxis nur wenig besser.
Ja und? mag der kontinentaleuropäische Beobachter jetzt sagen. Die SPD tritt auch alle fünf Jahre in Bayern an und holt sich tapfer ihren Prügel ab. Die Demokraten müssen dem Wähler doch eine Alternative bieten, schon allein der Parteilandschaft wegen.
Was uns zum zweiten Grund führt, der allerdings erfahrungsgemäß etwas schwieriger zu vermitteln ist. Deswegen schieben wir eine Übung ein.
Der interessierte Leser ziehe sich fette schwarze Stiefel, einen möglichst langen schwarzen Ledermantel und eine ultra-teure Sonnenbrille an. Wenn er seinen Partner dazu bringen kann, sich in hautengem Latex [JPG] an ihn zu klammern, um so besser. Dann hole er sich aus der Besteckschublade einen Löffel und halte ihn sich so vor das Gesicht, dass er seine eigene Nase sieht. Und jetzt mache sich der interessierte Leser klar:
Es gibt keinen Löffel.
Das sieht nur so aus. Alles Illusion. In Wirklichkeit gibt es den Löffel gar nicht.
Wenn der Leser sich das bewusst gemacht hat, die elementare Unwirklichkeit des Löffels sich ihm ins Gehirn gebrannt hat, wenn buddhistische Mönche aus Laos einfliegen, um zu seinen Füßen die anatta-Lehre der Nicht-Existenz zu empfangen, dann ist er bereit für die nächste Stufe der Erkenntnis:
Es gibt keine Parteien.
Das sieht nur so aus. Alles Illusion. In Wirklichkeit gibt es die Parteien gar nicht.
Wir haben schon erklärt, dass in den USA Menschen gewählt werden und nicht Parteien und dass die Verfassungsväter diese eigentlich als Teil des Problems und nicht der Lösung gesehen haben. Die Amerikaner haben lediglich zähneknirschend akzeptiert, dass Kandidaten sich ständig zu Gruppen zusammenschließen und haben ein paar Regeln aufgestellt, um das in gesittete Bahnen zu lenken.
Alle reden zwar ständig von den Parteien und die Wähler mögen sich mit einer Partei identifizieren und die Parteien halten vielleicht Vorwahlen ab und am Wahltag können die Wähler ihr Kreuz nach der Parteizugehörigkeit machen, denn das steht neben dem Namen. Aber am Ende werden Menschen gewählt.
In TX-14 treten daher eigentlich nicht zwei Republikaner, ein Libertarian und zwei Parteilose an, sondern die fünf aufrechten texanischen Bürger Paul, Peden, Flynn, Harvey und Roof. Dass keiner von ihnen zu einer Gruppe namens “Demokraten” gehört, ist dem System so schnurz wie die Frage, ob einer der Kandidaten im Kegelverein ist.
Die Demokraten können auch niemanden “stellen” oder von sich aus “antreten”, egal wie sehr die Parteiführung in Washington (und die Autoren von Daily Kos) sich das wünschen mag. Sie können nur darauf hoffen, dass ein wackerer Demokrat in Galveston beschließt, sich zu bewerben.
Nur, warum sollte jemand das tun?
Ein Kandidat würde sich die Plagen des Wahlkampfs aufhalsen und müsste für seine Finanzierung selbst sorgen. Was am Ende sein Lohn wäre, sagt der PVI ziemlich eindeutig voraus: Eine vernichtende Niederlage. Die nimmt aber nicht die Partei auf ihre Kappe wie die SPD in Bayern, sondern er persönlich.
Er wäre also nicht ein guter Parteisoldat, der später an anderer Stelle für sein Opfer belohnt werden würde, sondern nur der Depp, der so blöd war, eine völlig sinnlose Schlacht zu schlagen. Das ist nicht gut für die Karriere und vorlaute Rotznasen mit Glatze [JPG] würden auf der Straße über ihn lachen.
Der interessierte Leser mag in seiner bestimmt reichlich bemessenen Freizeit alle 435 Wahlbezirke durchgehen, um sich davon zu überzeugen, dass es solche Fälle auch mit umgekehrter Rollenverteilung gibt. In OR-04 (Oregon) treten zum Beispiel offenbar nur Peter DeFazio von den Demokraten und Mike Beilstein von der Pacific Green Party an, kein Republikaner.
Gewaltenteilung als Faktor bei der Präsidentenwahl
Deutsche haben bekanntlich Schwierigkeiten mit der Gewaltenteilung. Im Moment macht sich das insbesondere bei Diskussionen über die Präsidentschaftswahl bemerkbar. Wir zeigen daher heute am laufenden Wahlkampf, warum die Entscheidung für einen Kandidaten auch davon abhängen kann – einige Amerikaner würden sagen “abhängen sollte” oder “abhängen muss” – wie die Verhältnisse im Kongress aussehen.
(Dieser Autor möchte die folgende Diskussion nicht als Unterstützung für die eine oder andere Partei oder den einen oder anderen Kandidaten verstanden wissen. Für dieses Blog gilt ab sofort: Richard Wilkins III for President!)
Der interessierte Leser wird sich erinnern: Nicht der Präsident macht die Gesetze, sondern der Kongress, notfalls ohne und im Extremfall gegen ihn. Es gibt damit zwei bestimmende Mächte in der amerikanischen Alltagspolitik, die selbst dann zusammenarbeiten müssen, wenn dort verschiedene Parteien das Sagen haben.
Wenn nun alle vier Jahre die Präsidentschaftskandidaten auftreten, ihre auf Hochglanz polierten Programme vorstellen und mit leuchtenden Augen ihre Wahlversprechen aufsagen, stellt sich dem amerikanischen Wähler nicht nur die Frage, ob ihm das alles gefallen würde. Er überlegt sich auch: Kriegt er seine Wundergaben überhaupt durch den Kongress?
In diesem Wahljahr sind entprechende Planspiele einfach. Den Umfragen zufolge werden die Demokraten ihre Mehrheit im Senat wie im Repräsentantenhaus halten oder sogar ausbauen.
[Kaum ist dieser Eintrag fertig, sacken die Demokraten zum ersten Mal seit Monaten in den Umfragen deutlich ab. Nee, is‘ klar. Danke auch. Das ignorieren wir, denn es geht ums Prinzip und dieser Autor hat keine Zeit, alles umzuschreiben.]
Damit kann sich der Demokrat Barack Obama bei einem Sieg Hoffnungen machen, sein Wahlprogramm zumindest in groben Zügen umsetzen zu können. Für seine Anhänger wäre das der Idealzustand. Dabei hätten allerdings auch solche Programmpunkte eine Chance verwirklicht zu werden, die Republikanern als extrem gelten.
Umgekehrt wissen wir jetzt schon: Der Republikaner John McCain könnte als Präsident nur die Abschnitte seines Wahlprogramms durchsetzen, die den Demokraten in den Kram passen. Auch McCains Kandidaten für die Staats- und Regierungsämter – insbesondere die neuen Richter am Supreme Court – müssten erstmal am demokratischen Senat vorbei.
Damit können wir schon mal erklären, warum die Programme der Kandidaten unterschiedlich streng bewertet werden. Wenn McCain propagieren würde, alle Erstgeborenen Cthulhu zu opfern, würde das zwar Rückschlüsse auf seinen Charakter zulassen. Aber angesichts der Mehrheiten im Kongress ist das sonst bedeutungslos, denn so etwas machen die Demokraten natürlich nie mit. Ein Programmpunkt von Obama dagegen, für die Tinte der Dollar-Scheine das Blut von Jungfrauen zu verwenden, müsste viel ernster genommen werden. Bestimmt wollen das alle Demokraten.
Für eingefleischte Republikaner ist ein demokratischer Kongress natürlich eine Tragödie. Wie ihre demokratischen Gegenspieler wünschen sie sich zu Abermillionen nichts sehnlicher, als dass ihre Partei nicht nur die Präsidentschafts- und Kongresswahlen gewinnt, sondern am besten auch den Superbowl, den Stanley Cup und die World Series. Nur wenn alles in einer Hand ist, so das Argument der Parteianhänger, kriegt man etwas geschafft.
Es gibt in der Mitte des Spektrums aber eine andere politische Schule. Sie sagt, dass es besser ist, wenn alle Beteiligten mit Gewalt zum Kompromiss gezwungen werden. Eine Herrschaft einer Partei – egal welcher – über die Legislative und Exekutive macht diese Leute nervös. Genau diese Situation gab es schließlich in den ersten Jahren unter George W. Bush, und einige Amerikaner halten das Ergebnis für, äh, möglicherweise nicht ganz optimal. Das Letzte, das die USA jetzt bräuchten, wäre ein ähnlich extremer Ausschlag in die entgegengesetzte Richtung.
Damit ist der sich abzeichnende Sieg der Demokraten im Kongress für einige Amerikaner ein Argument dafür, ihre Stimme dem Republikaner McCain zu geben.
Jede Seite soll nur die halbe Macht bekommen, sagen diese Wähler. Dann könne man davon ausgehen, dass Kongress und Präsident das tun, was laut Verfassung zu ihren wichtigsten Aufgaben gehört: Sich gegenseitig zu kontrollieren. Extreme Gesetze fänden keine Mehrheit oder würden umgekehrt mit einem Veto zerquetscht. Demokrat und Demokraten oder Republikaner und Republikaner ist dagegen grundsätzlich schlecht, weil eine Krähe der anderen kein Auge aushackt.
Diese Denkweise ist Deutschen fremd, denn ohne Gewaltenteilung sind solche Strategien nicht möglich. Die Exekutive geht aus der Legislative hervor und der Kanzler wird ohne Mehrheit im Parlament gar nicht erst Kanzler. Es ist ein Entweder-Oder-System. Als Gegenstück kommt höchstens die Große Koalition in Frage, aber die wird selten vorher angekündigt, gilt meist als Notlösung und kann vom Wähler kaum bewusst herbeigeführt werden.
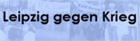


Viele Menschen fragen sich, warum die USA nicht einmal eine Partei hat die wenigstens so tut, als ob sie sozial wäre. Wenigstens irgendwas mit sozial im Namen. Bei ca. 40 Mio FoodStampsbeziehern, noch viel grösserer versteckter Armut und den MC-Jobbern gibt es doch ein Wählerpotential.
Woran liegt das ?Wie seht Ihr das ?
Verfasst von Logik-ist-Einfach | 20 März, 2014, 8:47 amJa die Eliten haben weltweit ein raffiniertes Parteien- und Mediensystem etabliert, das die Volksverblödung fördert.
Dieses Parteiensystem hat praktisch die Priester- und Adelsschicht ersetzt. Es blickt auf eine sehr sehr lange Tradition zurück.
Die Menschen können sich daraus nur befreien, wenn sie anfangen ihren Boden, ihr Land bewusst zu beanspruchen unzwar als Besitzer.
So wie die Ossis die rechtmässigen Besitzer der DDR sind, so sind auch die Indianer rechtmässiger Besitzer ihres Landes und sie haben sich ja bereits unabhängig erklärt. Aber genau wie die Ossis nur Bundesbürger zweiter Klasse sind, sind die Indianer nur Amerikaner zweiter Klasse.
Bevor sie nicht die gesamte Idiologie des Kapitalismus ablegen und die gesamte Gesellschaft in Frage stellen, solange werden sie das auch bleiben.
Aber das fällt jenen die nie anders gelebt haben, viel schwerer als jene die damit Erfahrung haben.
Solang man glaubt das man etwas nicht verdient hat, solang wehrt man sich auch nicht dagegen.
Verfasst von monopoli | 20 März, 2014, 3:49 pm