monopoli
Für eine objektive Aufarbeitung der DDR-Geschichte:
War die DDR bankrott und total marode?
Verdiente man da wirklich so wenig?
Gab es da keinen Leistungsgerechte Entlohnung?
Wieviel hat die Einheit dem Bürger gekostet?
Wir helfen Fiktion und Wirklichkeit zu unterscheiden und räumen mit einigen Vorurteilen auf.

- Was war die DDR wert und wo ist dieser Wert geblieben?
- Mangelwirtschaft_DDR?
- War die DDR bankrott und Pleite?
- Lohndifferenz in der DDR
- Abschlussbericht Ministerrat der DDR – Lage der Volkswirtschaft v. 23-01-1990
- Annexion der DDR
- Kosten der deutschen Einheit
- Zahlungsbilanz_DDR vs. Zahlungsbilanz_BRD
Die Verschuldung des öffentlichen Gesamthaushaltes gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich belief sich zum 31. Dezember 2012 auf 2 068 Milliarden Euro. Bezogen auf die Gesamtbevölkerungszahl ergab sich für den 31. Dezember 2012 eine durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung von 25 725 Euro.
Quelle: destatis aus Schulden Gesamthaushalt 2012Die Westdeutsche Beseitigungswirtschaft ab 1990
Der „Bankrott der DDR“ ist fester Bestandteil der in Medien verbreiteten Version des
„öffentlichen Bewusstseins“ über das Ende der DDR. Jüngstes Beispiel hierfür bildet die
Ausschlachtung des vorgeblichen „Staatsbankrotts der DDR“ in der Neuauflage des Buches
von Uwe Müller „Supergau Deutsche Einheit“ (Juli 2006), S. 58 ff.
Bis 1988 war in Westdeutschland die von der eigenen Forschung gestützte allgemeine
Auffassung verbreitet, dass die Wirtschaftsleistung je Einwohner in der DDR vor derjenigen
von England und Italien rangiere. Eng in Verbindung mit der Korrektur dieser Bewertung
seit der Vereinigung steht auch die Legende von der „total maroden DDR“.
Im Ergebnis der „Deindustrialisierung“ durch die Treuhandanstalt (THA) und ihrer
nachgelassenen Schulden wurde diese Legende von der „maroden DDR“ tatsächlich im
öffentlichen Bewusstsein verfestigt. Sie diente schon immer auch dem Ziel, die DDR
nachträglich in den Augen der Ostdeutschen zu delegitimieren und ein ideelles
„Trostpflaster“ auf die sozialen Wunden der hohen Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland zu
drücken.
Sämtliche Berichte reden eindeutig von einer hartnäckige Leugnung der verhängnisvollen
Transformationspolitik der Treuhand, die zur Deindustrialisierung Ostdeutschlands zwischen
1990-1995 führte. Diese Deindustrialisierung ist kein Produkt Ostdeutscher Mangelwirtschaft,
sondern Westdeutscher Selbstbedienungs- und Beseitigungswirtschaft - also der puren Gier.
Seitdem kämpft die Ostdeutsche Wirtschaft mit den Folgen und arbeitet auf dem Niveau von 65-67% des
Westdeutschen Niveaus, das keinerlei Deindustrialisierung erlebt hat. Dies ist vor allen Dingen den Ossis
zu verdanken die wesendlich mehr arbeiten, für wesendlich weniger Geld.
Auch die Kommunen und Gemeinden sind etwas weniger verschuldet und wirtschaften insgesamt besser.
Berlin und Sachsen-Anhalt sind jedoch Sorgenkinder.
Insbesondere die kleinen Ostbetriebe in Handel und Reparatur sind ein deutlicher Gewinn.
Ebenso die Struktur des Gesundheitswesens was aus der DDR übernommen wurde.
Was Ostdeutschland heute fehlt sind jene Großbetriebe, die allesamt brutal zerschlagen wurden.
Demzufolge hat Ostdeutschland einen sehr schwachen Export, aber ein sehr gutes Bildungsniveau.
Eine Dienstleistungswirtschaft ist im Osten mangels fehlender Industrie nur schwer realisierbar.
Ostdeutschland dient seit 1990 als Absatzmarkt für Westdeutschland.
Was die Politik vorsätzlich verschweigt:
Der Einbruch der Ostdeutschen Wirtschaft 1990 entspricht praktisch einem Kriegsschaden.
Ostdeutsche werden auf Jahrzehnte hinaus zweitklassige Bundesbürger bleiben, da diese Aufholjagd
der westdeutsche Maßstab für Entlohnung und Rente ist. Allein diese Aufholjagd dürfte mind. weitere
30 Jahre dauern. Und man darf annehmen, das sie dies dann noch weitere 10 Jahre leugnen werden, um auf
den Kosten der Ostdeutschen zu sparen.
Die Leistungsdifferenzierung zwischen West- und Ostdeutschland ist keine natürliche Gegebenheit, sondern
beruht auf die Zerstörung der Ostwirtschaft. Dies leugnet die CDU-SPD und stellt es als naturgegeben dar.
Sechzehn Jahre nach der Vereinigung ist das Bild der DDR rückwirkend aus ökonomischer
Sicht zu präzisieren. Eine Schwarz-Weiß-Malerei wäre zu relativieren und die Bewertungen
sind enger an den nachprüfbaren Fakten zu orientieren. Die nachfolgenden Ausführungen
zum „Staatsbankrott“ und zur „total maroden DDR“ stützen sich insgesamt auf eine Reihe
von Angaben und Veröffentlichungen bis in die jüngste Zeit, die entweder im
Literaturnachweis angeführt oder direkt mit Quellenangabe zitiert sind.
Und wie sieht es heute aus?
Resultat nach 23 Jahren BRD nach der totalen Deindustrialisierung –
Flächendeckender, völlig ungenügender Industrialisierungsgrad in Ostdeutschland
Auf die enorme Schrumpfung der Industrie infolge der Transformationskrise reagierten politische
und auch wissenschaftliche Wertungen in den ersten 90er Jahren mit dem Hinweis, hierbei handele es sich z.T. um einen Gesundungsprozess, da die DDR „überindustrialisiert“ gewesen wäre. Nach Fourastie ergäbe sich nunmehr für die ostdeutsche Region die Chance, einen breiten rasch wachsenden Dienstleistungssektor zu entwickeln. Fourasties >große Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts<, dass sich die Industriegesellschaft in eine >Dienstleistungsgesellschaft< wandeln werde, ist in den westlichen Industrieländern inzwischen eingetreten, aber: nicht unabhängig von Umfang und Struktur der Industrie.
„In Ostdeutschland zeigte sich allerdings ziemlich rasch, dass der Dienstleistungssektor für sich genommen ohne eine solide industrielle Basis, nicht für die nötige Schubkraft beim wirtschaftlichen Aufholprozess sorgen konnte.“24
Wobei zu berücksichtigen ist, dass viele Dienstleistungen für Produktion und Konsumtion von westdeutschen Standorten importiert werden, wie z.B. FuE-Leistungen (Forschung und Entwicklung), Beratungen, bzw. Dienstleistungsbetriebe Filialen westlicher Konzerne sind, wie z.B. fast alle Banken und Versicherungen.
Wie bereits erwähnt, entdeckte die schwarz-rote Regierung in ihrem Jahresbericht 2009 zum Stand der deutschen Einheit, dass die ökonomische Entwicklung regionale Unterschiede quasi als natürliches Ergebnis hervorbringe. Schließlich variierten auch im früheren Bundesgebiet Produktivität und Einkommen zwischen den einzelnen Bundesländern erheblich. Unausgesprochen steht dahinter die Hoffnung, der Leser des Berichts möge deshalb die Leistungsdifferenzierung zwischen West- und Ostdeutschland genau so als natürliche Gegebenheit betrachten, wie diejenige, die zwischen Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein besteht. Der Bericht unterschlägt damit die Folgen der Transformationskrise und klammert auch die verhängnisvolle Rolle der damaligen Wirtschaftspolitik aus.
Bei einer detaillierten Betrachtung der wirtschaftlichen Differenzierung zwischen den Bundesländern
im Osten und Westen aber springen die Folgen der Transformation Ostdeutschlands sofort ins Blickfeld:
- Das Gewicht der ost- in der gesamtdeutschen Industrie liegt erheblich unter dem Bevölkerungsanteil dieser Region. In den Neuen Ländern (ohne Berlin) lebten 2008 15,9 v.H. der gesamtdeutschen Bevölkerung, dort wurden jedoch nur 9,1 v.H. der deutschen Industrieumsätze erbracht – Indiz einer deutlichen Deindustrialisierung – Folge der Transformation.
- Die Industrieumsätze je Einwohner liegen nicht nur in jedem einzelnen der neuen Länder
durchweg unter dem durchschnittlichen westlichen Niveau, sie sind auch wesentlich
schwächer differenziert als dies zwischen den wd. Bundesländern der Fall ist. 2008 erreichte
keines der Neuen Länder das durchschnittliche gesamtdeutsche industrielle Umsatzniveau
je Einwohner, im Westen dagegen sechs Bundesländer. Ein weiteres Indiz für eine ungenügende Industrialisierung im Osten. - In keinem ostdeutschen Land wurde 2008 die durchschnittliche gesamtdeutsche Effektivität
der industriellen Produktion (Umsatz je Erwerbstätigen) erreicht, im Westen lag diese
Kennziffer in sieben Ländern z. T. wesentlich über dem gesamtdeutschen Niveau.
Dies ist ein klarer Hinweis auf große Unterschiede der industriellen Strukturen im Osten
gegenüber denen im Westen. Wiederum eindeutig Folgen der Transformation – z. B. der
Mangel an Großbetrieben. - Schließlich: keines der neuen Länder erreichte 2008 das durchschnittliche westdeutsche
industrielle Effektivitätsniveau (Umsatz je Erwerbstätigen). Hier klaffte eine so große Lücke,
die bereits vermuten lässt, dass sie nicht in einem absehbaren Zeitraum zu schließen
sein wird – wenn überhaupt. - Die Deindustrialisierung in Ostdeutschland widerspiegelt sich auch eindeutig in den Daten
für die in Industriebetrieben >Tätigen Personen<, wenn die beiden deutschen Regionen
verglichen werden (siehe Tabelle 6).
Im Jahre 2008 gab es in den Neuen Ländern (einschl. Berlin) je Einwohner ebenso viele Betriebe
des Verarbeitenden Gewerbes wie im früheren Bundesgebiet (o. Berlin). Werden nun
aber ihre Größe und Effektivität betrachtet, so klaffen große Differenzen auf. Die in diesen
Betrieben tätigen Personen waren nur 12 v.H. derjenigen in Deutschland insgesamt und sie erreichten nur 9,5 v.H. der gesamtdeutschen Entgelte.
Ihr Anteil an den gesamtdeutschen Umsätzen betrug 11,2 v.H. und an den Exporten 8,1 v.H. Alle diese Werte liegen beträchtlich unter dem Anteil der ostdeutschen an der gesamtdeutschen Bevölkerung, wie oben bereits dargestellt. Es sind jedoch nicht nur große Differenzen im Industrialisierungsgrad, die sich in
den genannten Zahlen ausdrücken, dahinter stehen auch deutliche qualitative Schwächen der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes in Ostdeutschland gegenüber denen im Westen.
Drei entscheidende Unterschiede fallen ins Auge:
- Die Betriebe im Osten sind im Durchschnitt, gemessen an der Zahl der tätigen Personen und des Umsatzes je Betrieb, wesentlich kleiner und leistungsschwächer als die im Westen, 2008 erzielten die od. Betriebe im Durchschnitt nur 54 v.H. des Umsatzes der wd. Betriebe. Sie sind auch wesentlich weniger exportintensiv.
- In den od. Betrieben erhielten die >Tätigen Personen< 2008 nur 71 v.H. der Entgelte, die in wd. Betrieben verdient wurden, obwohl sie 85 v.H.. des wd. Umsatzniveaus produzierten.
- Der Entgeltanteil am Umsatz lag 2008 im Osten deutlich unter dem im Westen.
Alle hier aufgeführten Merkmale sind nicht das Ergebnis einer normalen, differenzierten historischen
Entwicklung, vielmehr Folgen der wirtschaftspolitisch gesteuerten Transformation
nach dem Anschluss Ostdeutschlands an die Bundesrepublik.
Spannend bleibt die Frage, wann eine der künftigen Bundesregierungen diese historische Erbsünde; d. h. die hartnäckige Leugnung bzw. Ignorierung der verhängnisvollen Fehler in der Transformationspolitik, offiziell eingestehen wird.25
Defizite der Branchenstrukturen
Die bisherigen Daten zur Situation der Industrie in den neuen Ländern belegen zwingend,
dass zwischen ihr und der im Westen qualitative, d. h. strukturelle Unterschiede vorhanden
sein müssen. Die Transformation reduzierte nicht nur quantitativ den Industrialisierungsgrad,
sie schuf auch einen neuen Industrietyp in Ostdeutschland. Das wird deutlich, wenn die
Branchenstrukturen in beiden deutschen Regionen miteinander verglichen werden.
Traditionelle und regional orientierte Branchen dominieren
Bereits die grobe Gliederung nach den Hauptgruppen der Industrie in den beiden deutschen
Regionen macht die Folgen der Transformation sichtbar. Zunächst wiederum den Deindustrialisierungsgrad:
Im Jahre 2008 betrug der Anteil Ostdeutschlands am gesamtdeutschen industriellen Umsatz nur elf v. H. (siehe Tabelle 8). Im selben Jahr aber lebten zwanzig v. H. aller deutschen Einwohner in den neuen Ländern einschl. Berlin.
Vorleistungsgüter Ost: 38.9 West: 33.4
Investitionsgüter Ost: 28.7 West: 42.5
Gebrauchsgüter Ost: 2.8 West: 3.0
Verbrauchsgüter Ost: 24.7 West: 15.1
Energieproduzenten Ost: 4.9 West :6.0
Aufschlussreicher ist jedoch der Ost-West-Vergleich nach den Gewichten der einzelnen
Hauptgruppen der Industrie in deren Gesamtumsatz. Dabei fallen zwei gegensätzliche Unterschiede
auf: Das gegenüber dem Westen wesentlich geringere Gewicht der Investitionsgüter
einerseits und das bedeutend größere der Verbrauchsgüter andererseits. Beides unmittelbare
Auswirkungen der Transformation; denn
• als sich die westlichen Investoren (hauptsächlich die westdeutschen) die ostdeutschen
Betriebe aneigneten, konzentrierten sie sich zunächst auf die Eroberung der lokalen
Märkte, d. h. auf die Kapazitäten der Nahrungs- und Genußmittelbetriebe (Molkereien,
Milchverarbeitung, Mühlenbetriebe, Bäckereien, Schlachthöfe, Wurst- und Fleischverarbeitung
etc.) Dazu zählten auch die Großbetriebe der Energieversorgung (Braunkohlentagebaue26,
E-Kraftwerke, Gasanstalten etc.) und die der Rohstoffproduktion (Zementwerke,
Ziegeleien, Metallherstellung, Sägewerke etc.)
• der große Bereich der Investitionsgüter (Maschinenbau, Elektrotechnik, Regel-Meß- und
Steuertechnik u. a.) blieb zunächst vernachlässigt. Diese Waren wurden überwiegend
aus den westlichen Standorten auf die neuen Ostmärkte exportiert. Im Wettlauf um die
offenen Absatzchancen war dies effektiver, als die vorhandenen ostdeutschen Kapazitäten
zu modernisieren, konkurrenzfähig zu machen. Die westlichen Kapazitäten auszubauen
war der schnellere Weg. Infolge dieses Fehlstarts der Transformation blieb die für
die gesamte ostdeutsche Industrie wichtige Hauptgruppe bis heute untergewichtig. (Siehe
Tabelle 8)
• der annähernd gleiche Anteil der Gebrauchgüterindustrie am industriellen Umsatz in beiden
Regionen verwischt jedoch die unterschiedlichen Qualitäten: Im Osten fehlen, z. T.
fast vollständig, die Großbetriebe der Massenproduktion dieser Hauptgruppe, vor allem
von Kraftwagen und von elektrotechnischen sowie elektronischen Konsumgütern (z.B.
die Unterhaltungselektronik)
Die Tabelle 9 macht die qualitativen, für den Ost- West-Angleichungsprozeß von Effektivität
und Einkommen entscheidenden Unterschiede in den Industriestrukturen beider Regionen
sichtbar. Die Gruppe der Investitionsgüterproduzenten hat im Westen nicht nur das größte
Gewicht in der Industrie, sie verfügt auch über die höchste Effektivität gegenüber den anderen
Hauptgruppen, ausgenommen die Konzernbetriebe im Energiebereich, deren hohe organische
Zusammensetzung des Kapitals27 den Umsatz je Beschäftigen drastisch hochtreibt.
Demgegenüber bleibt diese wichtige, innovations- und FuE-intensive Hauptgruppe in
OD nur unterdurchschnittlich effektiv. Das gilt auch im Vergleich mit dem Effektivitätsniveau
der wd. Hauptgruppen. Die Investitionsgüterproduzenten im Osten wiesen 2008 gegenüber den anderen Hauptgruppen die größte Effektivitätslücke zum wd. Niveau aus. Der Umsatz je
tätige Person lag nur bei 71 v.H. desjenigen, der im Westen erzielt wurde, siehe Tabelle 9.
Dies besagt jedoch nicht, dass die od. Betriebe für Investitionsgüter in der Regel ineffektiv
sind, vielmehr schlagen sich in diesem Durchschnittswert der Hauptgruppe wiederum die
Folgen der Transformation nieder: die Mehrzahl ihrer Betriebe sind KMU und Kleinstbetriebe
mit Einzel- oder Kleinserienfertigung, bleiben mithin hinter der Effektivität von wd. starken
Mittel- und Großbetrieben weit zurück.
Eine weitere Besonderheit der od. Industriestruktur bilden die Verbrauchsgüterproduzenten.
Auffällig ist hier:
- der gegenüber dem Westen bedeutend höhere Anteil dieser Hauptgruppe am gesamten od. Industrieumsatz. (Siehe Tabelle 8) Er resultiert jedoch nicht daraus, dass diese Betriebe durch die Integration in den gesamtdeutschen Markt neue überregionale oder gar internationale Expansionsräume gewannen. Vielmehr ergibt sich ihr Gewicht ausschließlich aus dem insgesamt geringen Industrialisierungsgrad Ostdeutschlands. Der Anteil der od. Verbrauchsgüterproduzenten von 25 v.H. am od. industriellen Gesamtumsatz analog den 15 v.H. im Westen, ist mithin eine transformationsbedingte Disproportion, eben untypisch für die Struktur einer hochindustrialisierten Region. Verglichen mit dem Anteil der od. Verbrauchsgüterproduzenten am gesamtdeutschen Umsatz dieser Hauptgruppe wird erneut die Deindustrialisierung deutlich: er bleibt erheblich hinter dem Anteil der od. an der gesamtdeutschen Zahl der Einwohner – der 20 v.H. betrug – zurück. 2008 hatten die od. Verbrauchsgüterproduzenten einen Anteil von 17 v.H. am gesamtdeutschen Umsatz dieser Hauptgruppe. Der od. Markt für Verbrauchsgüter wird mithin nach wie vor in beträchtlichem Umfang von Kapazitäten außerhalb der Region versorgt.28
- aber auch die überdurchschnittliche Effektivität dieser Hauptgruppe, die sogar das westliche Niveau überschritten hat – hier gibt es keine Effektivitätslücke mehr. Die besitzergreifenden Investitionen der westlichen Eigentümer der Betriebe dieser Hauptgruppe, wie natürlich auch derjenigen, die im erfolgreichen Ostmanagement betrieben werden, haben moderne, konkurrenzfähige Kapazitäten geschaffen, die z. T. jünger und leistungsfähiger als viele im Westen sind. Ein Blick auf die Exportquoten dieser Hauptgruppe in beiden Regionen aber offenbart wiederum Transformationsfolgen: Die od. Quote liegt erheblich unter der wd. (siehe Tabelle 9) Das besagt, die Kapazitäten der od. Verbrauchsgüterproduzenten richteten sich vorwiegend auf die lokalen Märkte.
Die bisher dargelegten, transformationsbedingten Schwächen der Industrie in Ostdeutschland
haben gravierende Auswirkungen auf die Einkommen der dort Tätigen. Die größte Lücke im Ost-West-Annäherungsprozess klafft im Bereich der Entgelte. Im Jahre 2008 erhielten die in der Industrie >tätigen Personen< im Osten nur 72 v.H. der durchschnittlichen Entgelte die im Westen erzielt wurden. Dies, obwohl der Umsatz je >tätige Person< 85 v.H. des Westniveaus erreicht hatte und der Entgeltanteil am Umsatz beträchtlich unter dem westlichen Niveau lag. (Siehe Tabelle 10)
Auffällig ist, dass die größte Entgeltlücke zwischen den Investitionsgüterproduzenten liegt:
Im Osten verdienten die dort tätigen Personen 2008 nur 68 v.H. der Westentgelte. Verursacht
vor allem infolge der kleinbetrieblichen Struktur dieser od. Hauptgruppe. Die geringe
Differenz zwischen den Ost-West-Entgeltquoten ist ein Hinweis darauf, dass die od. Betriebe
im Investitionsgütergewerbe im harten Konkurrenzkampf stehen und über wenig Spielraum
in der Preisgestaltung ihrer Erzeugnisse verfügen, zugleich aber für hoch qualifizierte Mitarbeiter
angemessene Löhne- und Gehälter zahlen müssen.29
Auffällig ist weiter, dass es zwischen den Energieproduzenten 2008 keine Entgeltlücke mehr
gab. Sicher ein großer Erfolg der dort Tätigen. Das waren jedoch nur 1,3 v.H. aller tätigen
Personen in der od. Industrie.30
Zu berücksichtigen dabei bleibt, dass die handvoll internationaler Konzerne, die den od. Energiemarkt beherrschen, in den letzten Jahren ihre Monopolstellung rigoros für drastische Preissteigerungen missbrauchten, die in einzelnen Fällen zu gerichtlicher Überprüfung führten.
Schließlich ist auffällig, dass die Verbrauchsgüterproduzenten, die im Schnitt zum wd. Effektivitätsniveau
aufgeschlossen haben (siehe Tabelle 9), ihren tätigen Personen aber nur 81 v.H. des Niveaus der Westentgelte zahlten wobei deren Entgeltanteil am Umsatz erheblich
unter dem im Westen lag siehe Tabelle 10. Der grobe Ost-West-Vergleich der Industrie
nach Hauptgruppen zeigt
- Große Strukturdefizite im Osten (z. B. untergewichtige Investitionsgüterproduzenten)
- Erhebliche Differenzen im Anpassungsprozeß der einzelnen Hauptgruppen an das westliche Effektivitäts- und Entgeltniveau bei nach wie vor einer großen Lücke zwischen der Gesamtheit der Industrie in Ost und West.
- Noch immer liegen die Löhne und Gehälter fast aller Beschäftigten in der od. Industrie.um rund 30 v.H. unter dem wd. Niveau. Das hat erhebliche Auswirkungen auf diegesamte Wirtschaft der Region, z. B. auf die Entwicklung der Konsumtion, der Dienstleistungenund schließlich des Wirtschaftswachstums insgesamt.
- Alle Eigenheiten der ostdeutschen Strukturen sind transformationsbedingt, keineswegs Folgen einer normalen regional differenzierten ökonomischen Entwicklung.
Im Folgenden wird den industriellen Ost-West-Strukturunterschieden detaillierter nachgegangen,
um Tendenzen zu suchen, die den weiteren Annäherungsprozess an das westliche
Produktivitäts- und Einkommensniveau beeinflussen.
Ein erfolgreicher Aufholprozess für die Industrie in Ostdeutschland ist nur möglich, wenn es
gelänge, in breitem Umfange Zweige zu entwickeln, die mit innovativen Erzeugnissen national
und international neue Märkte erobern. In Europa sind gegenwärtig die Märkte für eingeführte
industrielle Produkte durchweg besetzt, um sie wird hart konkurriert. Hinzu kommt,
dass die sich neu industrialisierenden Länder Osteuropas sowie die aufstrebenden Industriestaaten
Asiens und Südamerikas auch für die Produzenten in Ostdeutschland Verdrängungskonkurrenten
sind und als solche stärker werden. Eines der wichtigsten Kriterien für
die Bewertung der künftigen Chancen, den Industrialisierungsgrad unter diesen Verhältnissen
zu erhöhen sowie Produktivität und Einkommen näher an das westdeutsche Niveau heranzubringen,
ist deshalb das Gewicht und die Dynamik von FuE-intensiven Industriezweigen31
in der od. Region. Zwar garantiert dieses Merkmal allein nicht den Erfolg, aber es ist
eine unverzichtbare Bedingung für den Aufholprozess.
Tarifbindung
Die hohe Arbeitslosigkeit in den n.Bl. hat auch dazu geführt, dass viele Unternehmen aus
den Flächentarifverträgen ausschieden und entweder gänzlich tarifungebundene Löhne und
Gehälter zahlen oder aber ihren Beschäftigten Firmen- bzw. Haustarife anbieten. Wenn Betriebe
nicht tarifgebunden entlohnen, ist das in der Regel mit Lohnminderung verbunden;
denn sonst erübrigte sich der Ausstieg.
Hochproduktive Betriebe auch in Ostdeutschland
Alle bisherigen Auswertungen zur Produktivität in Ost- und Westdeutschland sprechen dafür,
dass die Durchschnittsangaben der Produktivität sowohl nach Branchen als auch nach Betriebsgrößenklassen nach wie vor deutlich unterhalb vergleichbarer westdeutscher Werte
liegen. Damit werden den ostdeutschen Betriebe deutliche Produktivitätsrückstände attestiert.
Das wirft die Frage auf, ob es in Ostdeutschland auch hochproduktive Betriebe gibt, die
einem Vergleich mit Westdeutschland standhalten. Gibt es also auch in Ostdeutschland Betriebe,
deren Produktivität Spitzenwerte erreicht, oder sind ostdeutsche Betriebe hinsichtlich
der Produktivität von führenden westdeutschen Betrieben abgekoppelt?
Im bundesdeutschen Durchschnitt wurde 2010 ein Jahresumsatz von ca. 200 Tsd. € je VZÄ
erwirtschaftet. In Ostdeutschland beträgt der Anteil von Betrieben, in denen dieser Wert
übertroffen wurde, 12 % und in Westdeutschland 17 %. Jeder achte ostdeutsche Betrieb
realisierte also 2010 einen Jahresumsatz, der oberhalb des bundesdeutschen Durchschnitts
lag.
Von diesen hochproduktiven ostdeutschen Betrieben entfällt etwa jeder zweite auf den
Bereich Handel und Reparatur, jeder fünfte zählt zu den unternehmensnahen Dienstleistungen
sowie zum verarbeitenden Gewerbe. Hochproduktive westdeutsche Betriebe weisen
eine fast identische Branchenverteilung auf. Dieses Ergebnis war aufgrund der im Durchschnitt
deutlich niedrigeren Produktivität der Gesamtheit aller ostdeutschen Betriebe nicht
unbedingt zu erwarten. Insgesamt gibt es also auch in Ostdeutschland hochproduktive Betriebe,
die einem Vergleich mit westdeutschen Betrieben standhalten. In diesen hochproduktiven
ostdeutschen Betrieben waren allerdings nur 20 % aller Beschäftigten tätig, in Westdeutschland
demgegenüber 35 % (vgl. Abbildung 51).
Die Analysen verdeutlichen aber auch, dass es neben hochproduktiven Betrieben in Ostdeutschland
einen beträchtlichen Anteil von Betrieben gibt, in denen 2010 weniger als 50 Tsd. € je VZÄ realisiert wurden. Jeder dritte ostdeutsche Betrieb mit 25 % aller Beschäftigten ist demnach niedrigproduktiv. Die Verbreitung dieser Betriebsgruppe ist in Westdeutschland deutlich geringer. Nur jeder fünfte Betrieb mit einem Beschäftigungsanteil von 13 % erzielte in Westdeutschland ein Umsatzniveau unterhalb von 50 Tsd. €. Niedrigproduktive Betriebe gehören sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland vor allem den Dienstleistungsbranchen an.
Ost- wie westdeutsche Betriebe weisen damit eine hohe Produktivitätsspreizung auf. Dabei zeigte sich, dass im Vergleich mit Westdeutschland viele ostdeutsche Betriebe hohe Produktivitäten aufweisen, aber anteilig deutlich mehr Betriebe (mit hohen Beschäftigtenanteilen) niedrigproduktiv sind.
Chancen der Angleichung
Die Angaben aus dem IAB-Betriebspanel liefern eine Reihe von Informationen zur Leistungsfähigkeit
der ostdeutschen Wirtschaft, zu Ursachen des Produktivitätsrückstandes zu Westdeutschland,
welche zu ersten Ableitungen für künftige wirtschaftspolitische Erfordernisse genutzt werden können. Seit Anfang der 1990er Jahre haben sich in allen neuen Bundesländern landespezifische Wirtschaftsstrukturen herausgebildet. Der strukturelle Wandel in den ostdeutschen Ländern war transformationsbedingt und wird durch die jeweilige Landespolitik aktiv mitgestaltet. Inzwischen gibt es Branchenstrukturen, die von Land zu Land sehr unterschiedlich sind. Während beispielsweise 2011 in Thüringen 23 % aller Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe tätig waren und damit anteilig so viele wie in Westdeutschland, waren es in Mecklenburg-Vorpommern mit 11 % nur halb so viele. Demgegenüber setzt Mecklenburg-Vorpommern auf vorhandene Stärken des Landes wie den Tourismus und die Gesundheitswirtschaft, was mit hohen Beschäftigtenanteilen im Dienstleistungsbereich verbunden ist. Die Branchenstrukturen in den neuen Bundesländern verändern sich nur noch langsam.
Das heißt, es ist kaum mit positiven Struktureffekten auf die Produktivität zu rechnen, indem
hochproduktive Bereiche – wie z. B. die Industrie – an Gewicht gewinnen.
Ähnlich ist die Situation bei einer Betrachtung nach Betriebsgrößenklassen. Vergleicht man
die gegenwärtige Beschäftigungsstruktur nach der Betriebsgröße in Ost- und Westdeutschland
mit den Angaben von 1996, so zeigt sich eine eher divergierende (auseinander strebende) Entwicklung: Während 1996 in den ostdeutschen Großbetrieben mit 500 und mehr Beschäftigten noch 21 % aller
Beschäftigten tätig waren (Westdeutschland 24 %) ist infolge der Privatisierung, der Auflösung
der Kombinate der Beschäftigtenanteil in Betrieben dieser Größenordnung um die Jahrtausendwende
auf nur noch 14 % gesunken (Westdeutschland 21 %). Seitdem verharren die Beschäftigtenanteile auf diesem Niveau und kurzfristig ist keine Änderung zu erwarten.
Ostdeutschland ist ein interessanter Wirtschaftsstandort innerhalb Deutschlands. Verantwortlich
dafür zeichnen unter anderem das gute Qualifikationsniveau der Erwerbstätigen, die Innovationskraft vieler ostdeutscher Regionen, die leistungsstarken Hochschulen und die außeruniversitäre Forschung. Ostdeutschland verfügt über eine gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur und eine moderne Telekommunikationstechnik. In Verbindung mit günstigen Baulandpreisen sind die Arbeitskosten des ostdeutschen verarbeitenden Gewerbes im nationalen und teilweise im internationalen Vergleich konkurrenzfähig.
Fazit: Der Produktivitätsabstand zwischen den ost- und westdeutschen Betrieben stagniert
seit 2006 bei etwa 67 bis 69 % des Produktivitätsniveaus westdeutscher Betriebe. 2010 lag
die Angleichungsquote bei 67 %. Damit kann seit 2006 von einer zweiten Stagnationsphase
im Angleichungsprozess der Produktivität ausgegangen werden (erste Stagnationsphase
1995 bis 2000 mit einer Angleichungsquote von ca. 60 %). Die Produktivitätsspreizung der
ostdeutschen Betriebe ist hoch. Neben hochproduktiven Betrieben, deren Produktivitätsniveau
2010 oberhalb des bundesdeutschen Durchschnitts von ca. 200 Tsd. € je VZÄ lag
(12 % aller ostdeutschen Betriebe), gab es überdurchschnittlich viele niedrigproduktive Betriebe,
deren Produktivitätsniveau 50 Tsd. € je VZÄ nicht erreichte (33 % aller ostdeutschen
Betriebe).
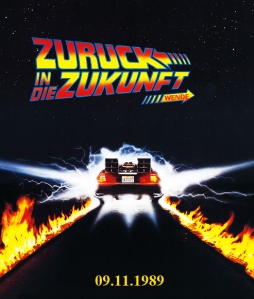 Mit anderen Worten, das ganze Gemurkse der BRD ist ein Haufen Mist.
Mit anderen Worten, das ganze Gemurkse der BRD ist ein Haufen Mist.
Den Firmen geht es schlecht, den Leuten geht es noch schlechter. Das kriegen wir alleine viel besser hin.
v. H. = von Hundert, entspricht Prozentangabe, 100% ist demnach Gesamtdeutschland FuE = Forschung und Entwicklung Quellen:
Aus dem IAB Betriebspanel Ost.
– Lage der Wirtschaft Ost 2011 (üblicherweise aufgehüpscht)
IAB-Betriebspanel Ost, Ergebnisse der sechzehnten Welle 2011,
Hrsg. Bundesministerium des Innern, Berlin, Juni 2012
– Lage der Wirtschaft Ost 2002 (üblicherweise aufgehüpscht)
IAB-Betriebspanel-Ost, Ergebnisse der siebten Welle des IAB-Betriebspanels-Ost 2002, Hrsg. Bundesministerium des Innern, Berlin, Februar 2003 IAB Berlin-Brandenburg – Die Gesundheitswirtschaft in Berlin-Brandenburg IAB Sachsen – Die sächsische Kultur- und Kreativwirtschaft als Arbeitgeber IAB Sachsen-Anhalt-Thüringen – Entwicklung der Erwerbslosigkeit in Thüringen Publikationen des Projekts: Das IAB-Betriebspanel Laufende Projekte des IAB Jährlich werden von Ende Juni bis Oktober bundesweit knapp 16.000 Betriebe aller Wirtschaftszweige und Größenklassen befragt. Die Befragung wird in persönlich-mündlichen Interviews von TNS Infratest Sozialforschung, München im Auftrag des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) durchgeführt. Diese repräsentative Betriebsbefragung umfasst ein breites Fragenspektrum zu einer Vielzahl beschäftigungspolitischer Themen, die in verschiedenen Forschungsprojekten untersucht werden.
Ergänzt wird das jährliche Standard-Fragenprogramm um jeweils aktuelle Themenschwerpunke. Mittlerweile existiert das IAB-Betriebspanel in Westdeutschland seit 1993 und in Ostdeutschland seit 1996 und stellt als umfassender Längsschnittdatensatz die Grundlage für die Erforschung der Nachfrageseite des Arbeitsmarktes dar.
Die Angaben der Betriebe sollen helfen, die Vermittlungs- und Beratungstätigkeiten der Bundesagentur für Arbeit näher an der betrieblichen Realität zu orientieren. Die Analysen werden auch zur Entscheidungsfindung von Politik, Tarifparteien und Verbänden genutzt. Einteilung der Wirtschaft nach Branchen:
| Produzierendes Gewerbe, Handel, Verkehr Schlüssel-Nr.: 01 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 02 Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 03 Energie- und Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung; Rückgewinnung Verarbeitendes Gewerbe 04 Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln 05 Herstellung von Textilien, Bekleidung, Lederwaren und Schuhen 06 Herstellung von Holzwaren, Papier, Pappe und Druckerzeugnissen 07 Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen, Kokerei und Mineralölverarbeitung 08 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 09 Herstellung von Glas und Keramik; Verarbeitung von Steinen und Erden 10 Metallerzeugung und -bearbeitung 11 Herstellung von Metallerzeugnissen, Stahl- und Leichtmetallbau 12 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen 13 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 14 Maschinenbau 15 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen, sonstiger Fahrzeugbau 16 Herstellung von Möbeln und sonstigen Waren (z. B. Schmuck, Sportgeräte, Spielwaren, medizinische Apparate und Materialien) 17 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen Baugewerbe 18 Hoch- und Tiefbau 19 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe Handel 20 Kraftfahrzeughandel und -reparatur 21 Großhandel und Handelsvermittlung 22 Einzelhandel, Tankstellen 23 Verkehr und Lagerei auch Parkhäuser, Bahnhöfe, Frachtumschlag, Post-, Kurier- und Expressdienste |
Dienstleistungen, Verwaltung 24 Information und Kommunikation Verlagswesen; Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen; Rundfunkveranstalter; Telekommunikation Informationstechnologische Dienstleistungen und Informationsdienstleistungen 25 Beherbergung und Gastronomie 26 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen Wirtschaftliche, wissenschaftliche und freiberufliche Dienstleistungen 27 Grundstücks- und Wohnungswesen 28 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 29 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung 30 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung 31 Forschung und Entwicklung 32 Werbung und Marktforschung, Design, Fotografie, Übersetzung 33 Veterinärwesen 34 Vermietung von beweglichen Sachen 35 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 36 Reisegewerbe, Wach- und Sicherheitsdienste, Garten- und Landschaftsbau, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 37 Erziehung und Unterricht 38 Gesundheits- und Sozialwesen Sonstige Dienstleistungen 39 Kunst, Unterhaltung, Erholung, Sport, Lotterie 40 Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern 41 Sonstige, überwiegend persönliche Dienstleistungen (z. B. Wäscherei, Friseur, Sauna) Organisationen ohne Erwerbscharakter, Öffentliche Verwaltung 42 Interessenvertretungen, Verbände, kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen 43 Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 44 Anderes, Sonstiges |
Wer war wer in der DDR
Who is Who – Zeitzeugen
Hier ein bisschen Literatur die Behauptungen der BRD ad absurdum führen:
Warum viele junge Ostdeutsche den Kapitalismus wieder loswerden wollen.
Und auch hier eine Studie junger Ostdeutscher die von 1987 bis 2010 begleitet wurden.
Zwei Jahrzehnte nach der deutscher Einheit ist die Generation der Mittdreißiger tief gespalten in Gewinner und Verlierer!
13 unerwünschte Reportagen
Neuausgabe: In Sachen Wallraff. Von den „Industriereportagen“ bis „Ganz unten“. Berichte, Analysen, Meinungen und Dokumente. Kiepenheuer & Witsch, Köln 1986.
Bei Wahlen macht ‚Bild‘ immer Politik für die Rechten aus: taz 21.11.2005
Ausgebeutet: Günter Wallraff als Niedriglöhner aus: DIE ZEIT magazin 01.05.2008
Notunterkunft für Obdachlose: „Ich will da nie wieder hin“, Frankfurter Allgemeine 2009


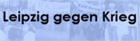


Diskussionen
Es gibt noch keine Kommentare.